Pflichtteil Steuer: Erbschaftsteuer, Freibetrag, Meldung

Zuletzt aktualisiert:
Ihre Lesezeit:
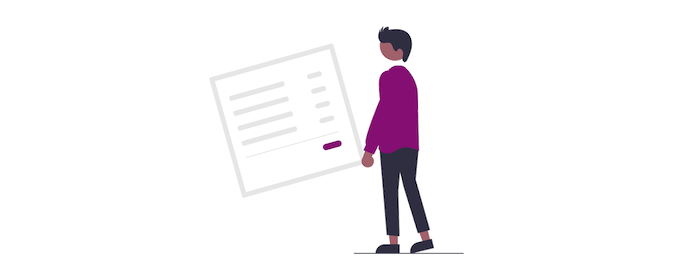
Pflichtteil Steuer
- Meldepflicht (3 Monate): Erwerb aus dem Anspruch ist innerhalb von drei Monaten beim zuständigen Erbschaftsteuer-Finanzamt anzuzeigen, auch wenn keine Steuer anfällt. Die fristgerechte Anzeige verhindert Schätzungen und Verspätungszuschläge; legen Sie Zahlungsbelege und Vereinbarungen gleich bei.
- Erbschaftsteuer & Freibetrag: Der geltend gemachte Anspruch zählt als Erwerb von Todes wegen und bleibt bis zum persönlichen Freibetrag steuerfrei; nur der darüber liegende Betrag wird nach Steuerklasse besteuert. Da die Steuer mit der Geltendmachung entsteht, sollten Sie Liquidität und mögliche Steuerzahlungen frühzeitig planen.
- Sonderfälle: Schenkung, Grunderwerb, Zinsen: Bei Verzicht gegen Abfindung oder unentgeltlichem Rückzug kann Schenkungsteuer anfallen, bei Übertragung einer Immobilie statt Geld Grunderwerbsteuer, und nur Verzugszinsen unterliegen der Einkommensteuer. Prüfen Sie notarielle Gestaltungsmöglichkeiten und holen Sie Steuerberatung, um unnötige Belastungen zu vermeiden.
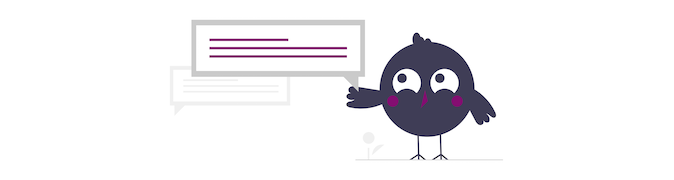
Herbert | HEREDITAS » Erb-Assistent
- Ihr digitaler Assistent für individuelle Fragen und verständliche Informationen. Die KI wertet alle Inhalte der Webseite aus und erklärt komplexe Themen einfach.
- Keine Anmeldung erforderlich.
- Kostenlos im Browser.



Pflichtteil und Steuern – Überblick und Pflichten
Wer einen Pflichtteil erhält, muss sich auch mit steuerlichen Fragen beschäftigen. Denn der Pflichtteil ist zwar kein Erbe im engeren Sinn, gilt steuerlich aber als Erwerb von Todes wegen. Dadurch kann er verschiedene Steuerarten berühren – von der Erbschaftsteuer bis hin zu Zinsen, die der Einkommensteuer unterliegen.
Welche Steuern beim Pflichtteil relevant sein können
Ein Pflichtteilsanspruch kann mehrere Steuerarten auslösen, je nachdem, wie er abgewickelt wird. Grundsätzlich gilt: Der Pflichtteil unterliegt der Erbschaftsteuer, wenn er geltend gemacht wird. In besonderen Fällen kommen Schenkungs-, Grunderwerb- oder Einkommensteuer hinzu.
Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Steuerarten im Zusammenhang mit dem Pflichtteil:
- Erbschaftsteuer: Pflichtteilsansprüche gelten als Erwerb von Todes wegen. Sie sind steuerpflichtig, sobald der Anspruch geltend gemacht wird. Die Steuer richtet sich nach Steuerklasse und Freibetrag (Details siehe Kapitel Erbschaftsteuer).
- Schenkungsteuer: Entsteht bei Gestaltungen wie einem Pflichtteilsverzicht gegen Abfindung oder einem Verzicht ohne Gegenleistung nach Geltendmachung. Dadurch kann der Pflichtteil zur steuerpflichtigen Schenkung werden.
- Grunderwerbsteuer: Wird fällig, wenn der Pflichtteil nicht in Geld, sondern durch die Übertragung einer Immobilie erfüllt wird. In solchen Fällen behandelt das Finanzamt den Vorgang wie einen Kauf.
- Einkommensteuer: Auf den Pflichtteilsbetrag selbst fällt keine Einkommensteuer an. Nur Zinsen auf eine verspätete Auszahlung gelten als steuerpflichtige Kapitalerträge.
Damit ist der steuerliche Rahmen abgesteckt: In der Regel betrifft Pflichtteilsberechtigte die Erbschaftsteuer, während die übrigen Steuerarten nur in Sonderfällen greifen.
Für eine präzise Berechnung und zur Einschätzung möglicher Steuerfolgen ist mein Erbschaftssteuerrechner hilfreich. Er zeigt, ob der eigene Anspruch über dem Freibetrag liegt und wann eine Steuererklärung notwendig wird.
Meldepflicht und Fristen gegenüber dem Finanzamt
Pflichtteilsberechtigte müssen den Erwerb ihres Pflichtteils innerhalb von drei Monaten beim Finanzamt anzeigen (§ 30 ErbStG). Zuständig ist das Erbschaftsteuer-Finanzamt am letzten Wohnsitz des Erblassers. Die Frist beginnt in der Regel mit der Auszahlung oder der Kenntnis des Anspruchs. Wird sie versäumt, kann das Finanzamt eine Schätzung vornehmen oder Verspätungszuschläge erheben.
In der Praxis erfolgt die Anzeige formlos oder über das Formular Erbschaftsteuererklärung (EST 1 A). Der Pflichtteilsbetrag wird dort in den entsprechenden Zeilen (aktuell Zeile 110 f.) eingetragen. Eine vollständige Erklärung verlangt das Finanzamt meist erst, wenn der Freibetrag überschritten sein könnte.
- Frist: Drei Monate ab Auszahlung oder Kenntnis des Anspruchs.
- Zuständigkeit: Finanzamt am letzten Wohnsitz des Erblassers.
- Formular: Erbschaftsteuererklärung (EST 1 A), Eintrag Pflichtteilsanspruch.
- Nachweise: Vereinbarungen, Zahlungsbelege, Zinsabrechnungen, ggf. notarielle Unterlagen.
Sie wurden enterbt? Pflichtteilsanspruch ohne finanzielles Risiko geltend machen!*

- Holen Sie sich Ihr Recht: Eine Enterbung ist in Deutschland nahezu unmöglich. Nur bei schweren Straftaten gegen den Erblasser oder einem notariellen Erbverzicht ist eine Enterbung möglich.
- Ohne Kostenrisiko: Mit Erbfinanz als Prozessfinanzierer brauchen Sie keine Angst vor wirtschaftlich stärkeren Erben haben – mein Partner trägt sämtliche Kosten des Rechtsstreits.
- Freie Anwaltswahl: Sie können sich Ihren Anwalt frei aussuchen – vorausgesetzt es ist ein Fachanwalt für Erbrecht. Gerne können Sie Erbfinanz auch nach Empfehlungen fragen.
Erbschaftsteuer auf den Pflichtteil
Wer seinen Pflichtteil geltend macht, muss in der Regel Erbschaftsteuer zahlen. Der Pflichtteil gilt steuerlich als Erwerb von Todes wegen und wird wie eine Erbschaft behandelt. Die Steuer entsteht erst, wenn der Anspruch tatsächlich eingefordert wird – nicht bereits beim Tod des Erblassers.
Steuerentstehung und Rechtsgrundlagen
Ein Pflichtteilsanspruch unterliegt gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG der Erbschaftsteuer. Steuerlich gilt er als Erwerb von Todes wegen, auch wenn der Berechtigte selbst nicht Erbe geworden ist. Maßgeblich ist der Zeitpunkt, in dem der Anspruch geltend gemacht oder eine Zahlung vereinbart wird (§ 9 Abs. 1 Nr. 1b ErbStG). Dadurch kann die Steuerpflicht auch erst Monate oder Jahre nach dem Erbfall entstehen.
Die Höhe der Erbschaftsteuer richtet sich nach der Steuerklasse und dem Freibetrag der berechtigten Person. Solange der Pflichtteil innerhalb des Freibetrags bleibt, fällt keine Steuer an. Erst wenn der Anspruch diesen überschreitet, wird der übersteigende Betrag nach den gesetzlichen Steuersätzen besteuert.
Freibeträge und Steuerklassen beim Pflichtteil
Pflichtteilsberechtigte profitieren von denselben Freibeträgen wie Erben. Die Steuerklasse bestimmt sich nach dem Verwandtschaftsgrad zum Erblasser. Nur der über den Freibetrag hinausgehende Teil des Pflichtteils wird versteuert. Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Werte:
| Pflichtteilsberechtigter | Freibetrag | Steuersatz (Klasse I) |
|---|---|---|
| Ehegatte / Lebenspartner | 500 000 € | 7 – 30 % |
| Kind (leiblich / adoptiert) | 400 000 € | 7 – 30 % |
| Enkelkind (wenn Elternteil vorverstorben) | 400 000 € | 7 – 30 % |
| Enkelkind (wenn Elternteil lebt) | 200 000 € | 7 – 30 % |
| Eltern des Erblassers | 100 000 € | 7 – 30 % |
Pflichtteilsberechtigte gehören somit immer zur günstigen Steuerklasse I. Erst bei weiter entfernten Verwandten oder fremden Erwerbern greifen die höheren Steuerklassen II und III mit geringeren Freibeträgen (20 000 €) und bis zu 50 % Steuersatz.
Abtretung oder Verkauf des Pflichtteilsanspruchs
Ein Pflichtteilsanspruch kann nach § 2317 Abs. 2 BGB übertragen oder verkauft werden. Der Erwerber tritt in die Rechte des Berechtigten ein. Erfolgt die Abtretung entgeltlich, löst sie keine Erbschaftsteuer aus. Bei unentgeltlicher Übertragung an Personen außerhalb der engen Familie entsteht jedoch Schenkungsteuer, meist mit nur 20 000 € Freibetrag.
Pflichtteil als Nachlassverbindlichkeit der Erben
Für die Erben mindert der geltend gemachte Pflichtteil die eigene Erbschaftsteuer. Nach § 10 Abs. 5 Nr. 2 ErbStG gilt der Pflichtteil als Nachlassverbindlichkeit. Das bedeutet: Der Wert des Nachlasses wird um den zu zahlenden Pflichtteil reduziert, bevor die Steuer berechnet wird.
- Ohne Pflichtteil: Erbe E erhält 500 000 € → Bemessungsgrundlage 500 000 €.
- Mit Pflichtteil: E schuldet 100 000 € → Bemessungsgrundlage 400 000 €.
Pflichtteil Steuer: Hätten Sie das gedacht? Zahlen, Daten, Fakten!
- 400 Mrd. €: Auf diese Summe wird das jährliche Erbvolumen in Deutschland geschätzt – je größer das Vermögen und je mehr Patchwork-Familien es gibt, desto häufiger kommt es zu Enterbungen oder Strategien zur Pflichtteilsumgehung.
- 5 %: So hoch ist der Anteil an Erbfällen, in denen es zu einer vollständigen Enterbung kommt – meistens trifft es leibliche Kinder.
- 20–30 %: In diesem Bereich liegt der Anteil der Pflichtteilsstreitigkeiten, die letztlich vor Gericht landen, meist wegen Uneinigkeit über Nachlassbewertung oder die konkrete Höhe des Pflichtteils.
E-Book: „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“
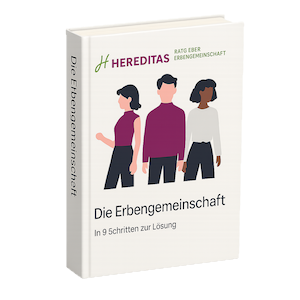
- Gratis-E-Book „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“: Mein Leitfaden, wie Sie Ihren Weg aus der Erbengemeinschaft finden. Exklusive und kostenfreie Zugabe zum Newsletter!
- Checkliste Todesfall: Die wichtigsten Aufgaben für Angehörige in den ersten Tagen und Wochen nach dem Todesfall. Ebenfalls kostenlos zum Newsletter!
- Der Newsletter: Nichts mehr verpassen. Meine exklusiven Insider-Tipps, neueste Beiträge und aktuelle Entwicklungen!
Schenkungsteuer-Konstellationen rund um den Pflichtteil
In bestimmten Fällen kann der Pflichtteil nicht nur Erbschaftsteuer, sondern auch Schenkungsteuer auslösen. Das betrifft vor allem Situationen, in denen der Pflichtteilsanspruch durch eine Abfindung abgegolten oder freiwillig aufgegeben wird. Schenkungsteuer entsteht immer dann, wenn eine Zuwendung ohne angemessene Gegenleistung erfolgt.
Pflichtteilsverzicht gegen Abfindung – steuerliche Folgen
Ein Pflichtteilsverzicht gegen Zahlung einer Abfindung ist eine häufige Gestaltung, um spätere Streitigkeiten im Erbfall zu vermeiden. Dabei verzichtet der Pflichtteilsberechtigte zu Lebzeiten des Erblassers auf sein Recht, erhält dafür aber einen Geldbetrag oder eine andere Leistung. Steuerlich gilt diese Abfindung als Schenkung nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG.
Die Schenkungsteuer richtet sich nach der Verwandtschaft zwischen dem Zahlenden und dem Empfänger. Es gelten dieselben Steuerklassen und Freibeträge wie bei der Erbschaftsteuer. Der gezahlte Betrag wird innerhalb von zehn Jahren mit anderen Schenkungen desselben Schenkers zusammengerechnet (§ 14 ErbStG). Dadurch kann eine hohe Abfindung den Freibetrag teilweise aufbrauchen.
- Wer zahlt? Der Erblasser oder ein Erbe leistet die Abfindung.
- Wem wird geschenkt? Dem Pflichtteilsverzichtenden, der damit auf seinen Anspruch verzichtet.
- Folge: Schenkungsteuerpflicht, sofern die Abfindung über dem Freibetrag liegt.
Verzicht nach Geltendmachung – Schenkung durch Unterlassen
Wird ein Pflichtteilsanspruch nachträglich ohne Gegenleistung aufgegeben, entsteht ebenfalls Schenkungsteuer. Der Berechtigte verzichtet dabei auf einen bereits bestehenden Zahlungsanspruch – für das Finanzamt gilt das als unentgeltliche Zuwendung an die Erben. Die Steuerpflicht richtet sich nach dem Verhältnis zwischen dem Verzichtenden und den Begünstigten.
Besonders kritisch sind Fälle, in denen Pflichtteilsberechtigte aus familiären Gründen oder nachträglicher Einigung auf ihren Anspruch verzichten. Ohne dokumentierte Gegenleistung bewertet das Finanzamt den Vorgang als freigebige Zuwendung (§ 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG). Damit kann selbst ein gut gemeinter Verzicht zu einer steuerpflichtigen Schenkung werden.
- Unentgeltlicher Verzicht: Schenkung des Anspruchs an die Erben.
- Teilweiser Verzicht: Nur der unentgeltliche Teil ist steuerpflichtig.
- Steuerklasse: Entspricht dem Verhältnis zwischen Verzichtendem und Erben (z. B. Geschwister = Klasse II).
Melden Sie den Erwerb Ihres Pflichtteils innerhalb von drei Monaten dem zuständigen Erbschaftsteuer-Finanzamt und legen Sie Zahlungsbelege, Verträge und Zinsnachweise bei, um Schätzungen und Verspätungszuschläge zu vermeiden. Lassen Sie vor einer Erfüllung in Form von Immobilien oder vor einem Verzicht/Abfindungsvertrag prüfen, ob Grunderwerbsteuer oder Schenkungsteuer anfällt, und gestalten Sie die Vereinbarung notariell mit Steuerberatung. Beachten Sie, dass der Pflichtteilsbetrag selbst einkommensteuerfrei ist, Verzugs‑ oder Stundungszinsen jedoch als Kapitalerträge zu versteuern sind und entsprechend nachzuweisen sind.

Persönlicher Experten-Tipp von Dr. Stephan Seitz
Grunderwerbsteuer bei Immobilien-Lösungen
Wird ein Pflichtteil nicht in Geld, sondern durch die Übertragung einer Immobilie erfüllt, kann zusätzlich Grunderwerbsteuer anfallen. Denn rechtlich gilt die Immobilie nicht als Teil des Erbes, sondern als Gegenleistung für eine Forderung. Dadurch entsteht ein steuerpflichtiger Erwerbsvorgang, obwohl die Beteiligten miteinander verwandt sind.
Immobilie als Pflichtteilsleistung – fällt Grunderwerbsteuer an?
Ja. Wird der Pflichtteil durch die Übereignung eines Grundstücks oder Hauses erfüllt, behandelt das Finanzamt dies als entgeltlichen Erwerb. Der Pflichtteilsberechtigte „bezahlt“ die Immobilie mit seinem Anspruch, der als Geldforderung gilt. Die Befreiung für Erwerbe von Todes wegen (§ 3 Nr. 2 GrEStG) greift hier nicht, weil es sich nicht um eine Erbschaft, sondern um die Erfüllung einer Schuld handelt.
Die Höhe der Grunderwerbsteuer richtet sich nach dem Immobilienwert und dem Steuersatz des Bundeslandes – zwischen 3,5 % und 6,5 %. Bemessungsgrundlage ist der Verkehrswert der Immobilie, unabhängig davon, ob der Pflichtteilsanspruch genau denselben Betrag hat.
- Auslöser: Erfüllung des Pflichtteils durch Übertragung einer Immobilie.
- Rechtsgrundlage: § 1 Abs. 1 Nr. 1 GrEStG – entgeltlicher Erwerb.
- Steuersatz: Je nach Bundesland 3,5 % – 6,5 % des Immobilienwerts.
- Ausnahme: Nur Erwerb von Todes wegen (§ 3 Nr. 2 GrEStG) ist befreit – hier nicht anwendbar.
Damit wird deutlich: Wer den Pflichtteil durch eine Immobilie ausgleichen will, muss die zusätzliche Grunderwerbsteuer einplanen. Es gibt jedoch eine Möglichkeit, diese Belastung zu vermeiden – durch eine geschickte vertragliche Gestaltung.
Grunderwerbsteuer vermeiden: Pflichtteilsverzicht gegen Grundstück
Die Grunderwerbsteuer lässt sich vermeiden, wenn die Übertragung der Immobilie nicht als Erfüllung, sondern als Abfindung für einen Verzicht auf den Pflichtteil gestaltet wird. In diesem Fall gilt der Erwerb als Erwerb von Todes wegen und bleibt nach § 3 Nr. 2 GrEStG grunderwerbsteuerfrei. Juristisch bedeutet das: Der Pflichtteilsberechtigte erhält die Immobilie nicht als Käufer, sondern als Erbe-Ersatz im Rahmen einer Erbregelung.
Diese Lösung setzt voraus, dass die Beteiligten den Verzichtsvertrag notariell vereinbaren, bevor die Immobilie übertragen wird. Nur dann erkennt das Finanzamt den Vorgang als steuerfreien Erwerb an. Gleichzeitig bleibt der Vorgang weiterhin der Erbschaftsteuer unterworfen, was aber regelmäßig günstiger ist als die zusätzliche Grunderwerbsteuer.
- Gestaltung: Pflichtteilsverzicht gegen Übereignung der Immobilie.
- Rechtsfolge: Grunderwerbsteuerbefreiung (§ 3 Nr. 2 GrEStG).
- Voraussetzung: Notarieller Vertrag, klarer Zusammenhang mit dem Erbfall.
- Steuerliche Wirkung: Nur Erbschaftsteuer, keine doppelte Belastung.
 Pflichtteil Steuer: Meine weiteren Artikel
Pflichtteil Steuer: Meine weiteren Artikel
 Verjährung Pflichtteilsanspruch: Darauf müssen Sie achten!Autor: Dr. Stephan Seitz
Verjährung Pflichtteilsanspruch: Darauf müssen Sie achten!Autor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 26. März 2025 Pflichtteil verkaufen: Geld statt langwieriger StreitAutor: Dr. Stephan Seitz
Pflichtteil verkaufen: Geld statt langwieriger StreitAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 8. Januar 2025 Pflichtteil zu gering? 10 Wege, Ihren Anspruch zu erhöhenAutor: Dr. Stephan Seitz
Pflichtteil zu gering? 10 Wege, Ihren Anspruch zu erhöhenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 9. November 2025 Pflichtteil zu Lebzeiten einfordern: Was geht, was nicht?Autor: Dr. Stephan Seitz
Pflichtteil zu Lebzeiten einfordern: Was geht, was nicht?Autor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 17. März 2025 Zusatzpflichtteil: Ihr Recht auf faire AufstockungAutor: Dr. Stephan Seitz
Zusatzpflichtteil: Ihr Recht auf faire AufstockungAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 26. März 2025 Pflichtteil Erbe: Berechtigung, Höhe und Durchsetzung!Autor: Dr. Stephan Seitz
Pflichtteil Erbe: Berechtigung, Höhe und Durchsetzung!Autor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 8. März 2025
Einkommensteuer – Pflichtteil und Zinsen
Der Pflichtteil selbst ist kein Einkommen im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Wer einen Pflichtteil erhält, muss diesen Betrag daher nicht in der Einkommensteuererklärung angeben. Steuerlich relevant wird nur, wenn auf den Pflichtteil Zinsen gezahlt werden – diese gelten als Einkünfte aus Kapitalvermögen.
Keine Einkommensteuer auf den Pflichtteil
Pflichtteilszahlungen sind Vermögensübertragungen von Todes wegen und damit nicht einkommensteuerpflichtig. Sie unterliegen ausschließlich der Erbschaftsteuer, sofern der Freibetrag überschritten wird. Eine doppelte Besteuerung durch Einkommensteuer ist gesetzlich ausgeschlossen (§ 2 Abs. 1 EStG in Verbindung mit § 3 ErbStG).
Das bedeutet: Der Pflichtteilsbetrag selbst bleibt steuerfrei, unabhängig davon, ob er bar ausgezahlt oder in Raten gezahlt wird. Eine Angabe in der Einkommensteuererklärung ist nicht erforderlich. Die Pflicht zur Meldung beim Finanzamt betrifft allein die Erbschaftsteuer.
- Erfasst: Geld-, Sach- oder Vergleichszahlungen aus einem Pflichtteilsanspruch.
- Nicht erfasst: Zinsen oder andere Erträge aus der Pflichtteilsforderung (separat steuerpflichtig).
- Rechtsgrundlage: Einkommensteuerfreiheit für Erwerbe von Todes wegen (§ 3 ErbStG).
Verzugs- und Stundungszinsen als Kapitalerträge
Wird der Pflichtteil nicht zeitnah ausgezahlt, können nach § 2331a BGB Verzugszinsen anfallen. Diese Zinsen gelten steuerlich als Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG). Sie unterliegen der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer.
Das bedeutet: Nur die Zinsen, nicht der Pflichtteil selbst, sind einkommensteuerpflichtig. Wer also eine Ratenzahlung oder verspätete Auszahlung erhält, muss die Zinsen in der Einkommensteuererklärung (Anlage KAP) angeben. Der Kapitalertrag wird im Jahr des Zuflusses versteuert.
- Verzugszinsen: Ab einem Jahr nach Erbfall oder bei gerichtlicher Durchsetzung des Anspruchs möglich.
- Steuersatz: 25 % Abgeltungsteuer + Soli (+ Kirchensteuer bei Zugehörigkeit).
- Bemessungsgrundlage: Nur die Zinsen, nicht der ursprüngliche Pflichtteilsbetrag.
- Nachweis: Zinsbescheinigung oder Vertrag mit Zinsvereinbarung als Beleg für das Finanzamt.
Sie wurden enterbt? Pflichtteilsanspruch ohne finanzielles Risiko geltend machen!*

- Holen Sie sich Ihr Recht: Eine Enterbung ist in Deutschland nahezu unmöglich. Nur bei schweren Straftaten gegen den Erblasser oder einem notariellen Erbverzicht ist eine Enterbung möglich.
- Ohne Kostenrisiko: Mit Erbfinanz als Prozessfinanzierer brauchen Sie keine Angst vor wirtschaftlich stärkeren Erben haben – mein Partner trägt sämtliche Kosten des Rechtsstreits.
- Freie Anwaltswahl: Sie können sich Ihren Anwalt frei aussuchen – vorausgesetzt es ist ein Fachanwalt für Erbrecht. Gerne können Sie Erbfinanz auch nach Empfehlungen fragen.
Pflichtteilsergänzung und Steuer (10-Jahres-Regel)
Hat der Erblasser zu Lebzeiten Vermögen verschenkt, können enterbte Angehörige ihren Pflichtteil um diese Schenkungen ergänzen. Dieser sogenannte Pflichtteilsergänzungsanspruch (§ 2325 BGB) verhindert, dass Pflichtteilsberechtigte durch vorweggenommene Schenkungen leer ausgehen. Auch dieser Ergänzungsanspruch unterliegt der Erbschaftsteuer, sobald er geltend gemacht wird.
Schenkungen und 10-Jahres-Abschmelzung
Bei der Pflichtteilsergänzung werden Schenkungen, die der Erblasser in den letzten zehn Jahren vor seinem Tod gemacht hat, anteilig dem Nachlass hinzugerechnet. Dadurch erhöht sich der Pflichtteilsanspruch des Enterbten. Der Anrechnungswert der Schenkung verringert sich jedes Jahr um zehn Prozent – nach zehn Jahren bleibt sie unberücksichtigt.
Die Regel soll sicherstellen, dass nur nahe zurückliegende Schenkungen den Pflichtteil beeinflussen. Entscheidend ist der Zeitpunkt der Schenkung, nicht der des Erbfalls. Das folgende Schema verdeutlicht, wie die Abschmelzung berechnet wird:
- 1 Jahr vor Tod: 90 % der Schenkung werden angerechnet.
- 5 Jahre vor Tod: 50 % werden berücksichtigt.
- 9 Jahre vor Tod: 10 % fließen noch in die Berechnung ein.
- Mehr als 10 Jahre: 0 % – Schenkungen sind steuerlich und pflichtteilsrechtlich irrelevant.
Steuerliche Auswirkungen der Pflichtteilsergänzung
Der durch die Ergänzung erhöhte Pflichtteilsbetrag gilt steuerlich als Bestandteil des Pflichtteils und unterliegt der Erbschaftsteuer. Das bedeutet: Der Pflichtteilsberechtigte muss den zusätzlichen Betrag versteuern, sobald er ihn geltend macht. Dabei gelten dieselben Freibeträge und Steuerklassen wie beim normalen Pflichtteil.
Für den Beschenkten kann es zunächst zu einer scheinbaren Doppelbelastung kommen: Er hat unter Umständen bereits Schenkungsteuer gezahlt, während der Pflichtteilsberechtigte nun auf den Ergänzungsbetrag Erbschaftsteuer entrichten muss. Muss der Beschenkte jedoch wegen des Pflichtteilsergänzungsanspruchs einen Teil der Schenkung herausgeben oder deren Wert erstatten, kann er nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG die anteilige Schenkungsteuer vom Finanzamt zurückfordern. Dadurch wird eine tatsächliche Doppelbesteuerung vermieden.
- Pflichtteilsberechtigter: versteuert den Ergänzungsbetrag mit Erbschaftsteuer.
- Beschenkter: kann anteilige Schenkungsteuer zurückfordern, wenn er Werte herausgeben muss (§ 29 ErbStG).
- Dauerhafte Doppelbelastung: entsteht nur, wenn keine Herausgabe erfolgt.
- Lösung: frühzeitige Nachlassplanung und rechtzeitige Schenkungen.
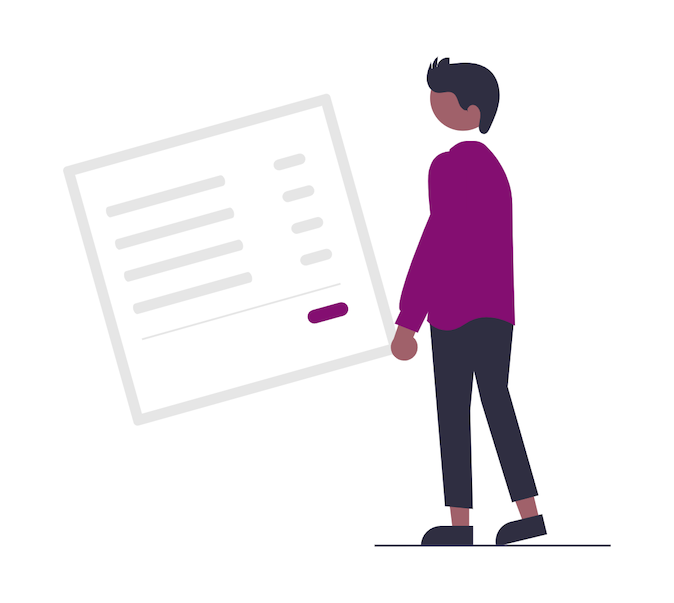
Häufig gestellte Fragen
Ist der Pflichtteil erbschaftsteuerpflichtig?
Muss ich den Pflichtteil dem Finanzamt melden und wie wirken Freibeträge?
Wann löst ein Pflichtteil Schenkungsteuer aus?
Fällt Grunderwerbsteuer an, wenn ich den Pflichtteil in Form einer Immobilie erhalte?
Quellenangaben und weiterführende Literatur
Die Informationen auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert und zusammengetragen. Folgende Quellen und weiterführende Literatur empfehle ich im Kontext Pflichtteil Steuer:
Dieser Beitrag wurde recherchiert und veröffentlicht von Dr. Stephan Seitz
Mein Name ist Dr. Stephan Seitz. Ich habe an der LMU München Jura studiert, 2006 mein Staatsexamen abgelegt und anschließend an der Universität Regensburg promoviert. Seitdem verbinde ich juristisches Fachwissen mit meinen eigenen Erfahrungen im Erbrecht und lasse dieses Wissen in meinen Ratgeber einfließen. Mehr zu meinem Werdegang und beruflichen Stationen finden Sie bei Interesse auf LinkedIn.
Die Idee zu dieser Webseite entstand, als ich selbst Teil einer Erbengemeinschaft war. Ich habe die Spannungen, rechtlichen Fragen und Unsicherheiten, die viele Miterben belasten, hautnah erlebt. Mit HEREDITAS » Ratgeber Erbengemeinschaft möchte ich juristische Grundlagen und Lösungswege verständlich darstellen und so Orientierung bieten.
Meine Inhalte sind für Sie kostenfrei. Mögliche Werbelinks, die zur Finanzierung beitragen, sind transparent gekennzeichnet.
Sie erreichen mich über die Kontaktseite.



Kommentare
Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!