
Erstveröffentlichung am 03. September 2016, zuletzt aktualisiert am 18. September 2024. Autor: Dr. jur. Stephan Seitz
Pflichtteil Erbe: Höhe des Pflichtteilsanspruchs ermitteln, Nachlasswert bestimmen, Pflichtteil einfordern
12 Minuten sinnvoll investierte Lesezeit
Inhaltsverzeichnis: Darum geht es auf dieser Seite
- Kreis der pflichtteilsberechtigten Personen
- Rechtlicher Hintergrund: Bedeutung des Pflichtteils im deutschen Erbrecht
- Können Kinder den Pflichtteil schon zu Lebzeiten der Eltern einfordern?
- Kann ich meinen Pflichtteil auch verkaufen?
- Was bewirkt der Verzicht auf den Pflichtteil, was der vollständige Erbverzicht?
- Besteht der Pflichtteilsanspruch auch nach Ausschlagung der Erbschaft?
- Wie hoch ist der Pflichtteil für Kinder und Abkömmlinge?
- Wie hoch ist der Pflichtteil des Ehegatten in der Zugewinngemeinschaft?
- Wie hoch ist der Pflichtteil des Ehegatten bei Gütertrennung?
- Welchen Inhalt hat der Pflichtteilsanspruch?
- Wie berechne ich die Höhe meines Pflichtteils?
- Welche Verbindlichkeiten kann der Erbe bei der Berechnung des Pflichtteils abziehen?
- Wann bin ich vom Pflichtteil ausgeschlossen?
- Können Enkel den Pflichtteil einfordern, wenn dem Elternteil der Pflichtteil entzogen wurde?
- Wann greift die Pflichtteilsstrafklausel?

Mein Name ist Stephan Seitz, ich bin Jurist und war vor wenigen Jahren selbst Teil einer Erbengemeinschaft. Dabei wurde mir klar: Miterben wollen keinen Streit, sondern eine Lösung. Alles was Sie dafür wissen müssen, schreibe ich hier auf. Mehr zu meiner Person.
Bitte beachten Sie meine rechtlichen Hinweise für diese Webseite. Der Inhalt dient ausschließlich der allgemeinen Information und Bildung sowie zur Unterhaltung. Für eine verbindliche Auskunft wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt, Steuerberater oder vergleichbaren Experten auf dem jeweiligen Fachgebiet.
Pflichtteilsberechtigung: Wer erhält den Pflichtteil?
Kreis der pflichtteilsberechtigten Personen
Der Kreis der pflichtteilsberechtigten Personen ist vor dem gerade beschriebenen Zweck eng umrissen. Pflichtteilsberechtigt sind nur die nächsten Familienangehörigen des Erblassers. Es gibt drei Gruppen, die hierfür in Betracht kommen:
- Abkömmlinge des Erblassers, also Kinder, Kindeskinder usw. sowie Adoptivkinder; nichteheliche Kinder sind selbstverständlich auch Abkömmlinge und damit ebenfalls pflichtteilsberechtigt. Nur der „nächste“ Abkömmlinge ist pflichtteilsberechtigt, d.h. hat der Erblasser Kinder, so sind damit Kindeskinder usw. ausgeschlossen
- Ehegatte bzw. der eingetragene Lebenspartner des Erblassers
- Eltern des Erblassers, sofern zum Todeszeitpunkt keine Abkömmlinge (mehr) vorhanden sind
Mit diesen drei eng umrissenen Gruppen sind bereits alle pflichtteilsberechtigten Personen beschrieben. Weitere Angehörige können vom Erblasser jederzeit und vollständig enterbt werden.
Rechtlicher Hintergrund: Bedeutung des Pflichtteils im deutschen Erbrecht
Der Pflichtteil existiert, um nahe Angehörige eines Erblassers, wie Kinder, Ehepartner oder Eltern, vor vollständiger Enterbung zu schützen und ihnen einen Mindestanteil am Nachlass zu sichern. Diese Regelung soll verhindern, dass emotionale oder situative Gründe dazu führen, dass berechtigte Personen völlig leer ausgehen. Der Pflichtteil stellt somit sicher, dass die wirtschaftliche Absicherung der engsten Familienmitglieder auch dann gewährleistet bleibt, wenn der Erblasser anderweitige Verfügungen getroffen hat. Dieses gesetzliche Schutzrecht dient dem sozialen Ausgleich und der Wahrung des familiären Zusammenhalts, indem es die finanziellen Interessen der nächsten Angehörigen wahrt.
Können Kinder den Pflichtteil schon zu Lebzeiten der Eltern einfordern?
Der Pflichtteil entsteht erst mit dem Erbfall. Vor Eintritt des Erbfalls können Sie Ihren Pflichtteil nicht geltend machen. Sie haben keinen Anspruch darauf, dass Ihr noch lebender Elternteil Ihnen den Pflichtteil vorzeitig auszahlt. Erhalten Sie trotzdem finanzielle Zuwendungen, ist es die freie Entscheidung Ihres Elternteils. Ihr Elternteil kann frei bestimmen, ob die Zuwendung auf Ihr Erbe angerechnet wird oder nicht. Zu Lebzeiten Ihres Elternteils haben Sie auch kein Recht auf Einsichtnahme in das Grundbuch, um die Eigentumsverhältnisse oder Wertverhältnisse einer Immobilie festzustellen.
Kann ich meinen Pflichtteil auch verkaufen?
Ja, auch der Pflichtteilsanspruch kann verkauft werden. Es handelt sich um einen schuldrechtlichen Anspruch, den Sie übertragen können. So können Sie zügig den wirtschaftlichen Wert des Anspruchs heben ohne in langwierige rechtliche Auseinandersetzungen verwickelt zu sein. Natürlich wird der Käufer für diese Aufwände einen Abschlag beim Kaufpreis vornehmen.
Im Detail stellen sich vielfältige Fragen wer pflichtteilsberechtigt ist. Insbesondere kann sich aus dem Ehestatus und dem Geburtsdatum bei adopierten Kindern im Einzelfall abweichendes ergeben. Lesen Sie Details zur Pflichtteilsberechtigung: Wer hat Anspruch auf den Pflichtteil und wer nicht?
Ausschluss vom Pflichtteil: Wann geht der Pflichtteilsanspruch verloren?
Was bewirkt der Verzicht auf den Pflichtteil, was der vollständige Erbverzicht?
Sind Sie pflichtteilsberechtigt, können Sie in Form der notariellen Beurkundung mit dem Erblasser auf Ihr gesetzliches Erbrecht insgesamt verzichten. Der Erbverzicht schließt Ihren Verzicht auf das Pflichtteilsrecht ein. Sie können aber auch allein auf das Pflichtteilsrecht verzichten.
Beim Erbverzicht verzichten Sie auf Ihr gesamtes gesetzliches Erbrecht. Dies bedeutet, dass Sie und Ihre Nachkommen von der Erbfolge ausgeschlossen sind. Der Erbverzicht muss notariell beurkundet werden und ist unwiderruflich. Die Auswirkungen eines Erbverzichts sind, dass Sie keinen Anspruch auf den Nachlass haben und der Erblasser frei über den Nachlass verfügen kann. In Bezug auf die übrigen Miterben erhöht sich deren Anteil am Nachlass, da der Anteil des Verzichtenden nicht mehr berücksichtigt wird. Dadurch erhöht sich der Pflichtteil jedes verbleibenden Berechtigten entsprechend, da die Berechnungsgrundlage größer wird.
Beim Verzicht auf das Pflichtteilsrecht verzichten Sie lediglich auf Ihren Pflichtteilsanspruch, nicht jedoch auf Ihr gesetzliches Erbrecht insgesamt. Auch dieser Verzicht muss notariell beurkundet werden. Die Auswirkungen des Verzichts auf das Pflichtteilsrecht sind, dass Sie Ihr gesetzliches Erbrecht behalten, aber keinen Pflichtteilsanspruch geltend machen können, wenn Sie enterbt werden. Der Erblasser kann somit ohne Pflichtteilsansprüche des Verzichtenden über den Nachlass verfügen. Für die übrigen Pflichtteilsberechtigten hat dies zur Folge, dass der Verzichtende weiterhin als Erbe betrachtet wird, wenn er nicht enterbt ist, und sein Anteil bei der Berechnung der Erbquote berücksichtigt wird. Falls der Verzichtende enterbt ist und nur auf den Pflichtteil verzichtet hat, hat dies keine direkte Auswirkung auf die Höhe der Pflichtteile der übrigen Berechtigten, da der Pflichtteil des Verzichtenden in diesem Fall entfällt und nicht auf die anderen Pflichtteilsberechtigten umverteilt wird.
Besteht der Pflichtteilsanspruch auch nach Ausschlagung der Erbschaft?
Schlagen Sie die Erbschaft aus, verlieren Sie auch Ihren Anspruch auf den Pflichtteil. Sie haben also nicht die Möglichkeit, sich im Wege der Ausschlagung von Ihren Pflichten als Erbe zu befreien, zugleich aber die Früchte des Pflichtteils zu ernten und die verbleibenden Erben wegen des Pflichtteils finanziell in Anspruch zu nehmen. Vielmehr erlischt mit der Ausschlagung Ihr Rechtsverhältnis zum Erblasser und damit auch Ihre Rechtsposition als Pflichtteilsberechtigter. Das Pflichtteilsrecht begründet nämlich nur eine Mindestteilhabe am Nachlass, für den Fall, dass Sie enterbt werden, nicht aber für den Fall, dass Sie die Erbschaft nicht annehmen. Eine Ausnahme besteht nur für Ehepartner. Ehepartner haben die Wahl zwischen dem großen und kleinen Pflichtteil.
Der Ausschluss vom Pflichtteil ist nur in sehr eingeschränkten Fällen möglich. Der Pflichtteilsanspruch geht verloren, wenn der Pflichtteilsberechtigte auf seinen Pflicht- oder Erbteil notariell verzichtet hat (§ 2348 BGB), der Pflichtteilsberechtigte nach dem Erbfall im Wege einer Anfechtungsklage für erbunwürdig erklärt wurde (§ 2339 BGB), der Erblasser in einer letztwilligen Verfügung den Pflichtteil entzogen hat (§ 2333 BGB) oder der Erbe die Erbschaft ausgeschlagen hat. Lesen Sie die Details zum Ausschluss vom Pflichtteil.
Wie hoch ist die prozentuale Pflichtteilsquote?
Wie hoch ist der Pflichtteil für Kinder und Abkömmlinge?
Der Pflichtteil beläuft sich auf die Hälfte des gesetzlichen Erbrechts. Gerichtet ist er allerdings nicht auf entsprechende Beteiligung an der Erbschaft, sondern nur auf einen Anspruch auf entsprechende Ausgleichszahlung, d.h. Geld. Für die Wertberechnung kommt es auf den Todeszeitpunkt an. Spätere Wertsteigerungen oder Wertverluste finden keinen Eingang in die Wertberechnung. Für die Berechnung des Nachlasswertes werden sowohl die Vermögensgegenstände wie auch die Nachlassverbindlichkeiten bewertet. Zusätzlich werden die Bestattungskosten und die Kosten zur Wertermittlung des Nachlasses in Abzug gebracht. Auf den nun ermittelten Wert wird der Pflichtteil mit 50% des gesetzlichen Erbteils berechnet.
Um den Pflichtteil zu berechnen, müssen Sie zunächst feststellen, wie hoch Ihr gesetzlicher Erbteil wäre, wenn Sie der Erblasser nicht enterbt hätte. Ihr gesetzlicher Erbteil hängt davon ab, wie viele erbberechtigte Personen es gibt und welcher Erbordnung diese angehören (Erben 1. Ordnung, 2. Ordnung pp) sind. Mitgezählt werden Personen, die wegen Enterbung, Ausschlagung der Erbschaft oder Erbunwürdigkeit nicht Erbe geworden sind. Mitgezählt wird auch, wenn nur auf seinen Pflichtteil verzichtet hat. Je mehr Erben es gibt, umso geringer ist der gesetzliche Erbteil und damit auch der Pflichtteil des Einzelnen. Nicht mitgezählt wird jedoch, wer auf sein Erbrecht gänzlich verzichtet hat.
Wie hoch ist der Pflichtteil des Ehegatten in der Zugewinngemeinschaft?
Sind Sie der überlebende Ehegatte, gelten in Bezug auf den Pflichtteil besondere Regelungen.
- Ist der Pflichtteil für Sie kein Thema und lebten Sie im gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, können Sie die Erbschaft annehmen und deren Ergänzung auf den Wert des sogenannten großen, um ein Viertel des Nachlasses erhöhten Pflichtteils verlangen. Dadurch erhöht sich Ihr gesetzlicher Erbteil als Ehegatte durch den Erbfall begründeten Zugewinnausgleich um ein Viertel. Statt dieser erbrechtlichen Lösung (auch großer Pflichtteil genannt) können Sie sich auch für die güterrechtliche Lösung (auch kleiner Pflichtteil genannt) entscheiden. Sie haben als Ehepartner ein Wahlrecht.
- Der große Pflichtteil berechnet sich nach Ihrem gesetzlichen Erbteil als Ehegatte unter Einbeziehung des zusätzlichen Viertels aus dem Zugewinnausgleich. Haben Sie Kinder, erben Sie ein Viertel des Nachlasses. Ihr Erbteil erhöht sich dann um ein Viertel der Erbschaft. Damit wird Ihr Zugewinn pauschal ausgeglichen. Fällt der Zugewinn aufgrund des Vermögenszuwachses Ihres Ehepartners während der Ehe hoch aus, fahren Sie jedoch mit dem kleinen Pflichtteil besser. Dazu schlagen Sie das Erbe aus, berechnen konkret den Zugewinn und erhalten als kleinen Pflichtteil den Erbteil, der sich unter Berücksichtigung Ihres gesetzlichen Erbrechts ergibt. Als gesetzlicher Erbe haben Sie ein Wahlrecht zwischen dem großen und dem kleinen Pflichtteil.
- Sind Sie Alleinerbe Ihres Ehepartners, bekommen Sie ohnehin erst einmal alles. Hat Ihr Ehepartner in einem Testament Vermächtnisse und Auflagen oder auch die Vor- und Nacherbfolge angeordnet, kann es besser sein, wenn Sie die Erbschaft ausschlagen und den kleinen Pflichtteil verlangen. In diesem Fall können Sie gleichfalls Ihren Zugewinn, der sich aus dem Vermögenszuwachs Ihres verstorbenen Ehepartners während der Ehe errechnet, konkret berechnen und einfordern und zusätzlich den kleinen Pflichtteil verlangen. Der kleine Pflichtteil beträgt die Hälfte des gesetzlichen Erbteils.
- Hat Sie Ihr Ehegatte testamentarisch jedoch völlig enterbt, haben Sie keinen Anspruch auf den großen Pflichtteil. Ihnen verbleibt nur der kleine Pflichtteil nebst Zugewinnausgleich.
- Nochmals klar ausgedrückt: Das Thema Pflichtteil wird nur relevant, wenn Sie als Ehepartner statt des großen Pflichtteils wegen des hohen Zugewinns den kleinen Pflichtteil verlangen und dazu die Erbschaft Ihres verstorbenen Ehegatten ausschlagen oder Sie von Ihrem verstorbenen Ehepartner testamentarisch enterbt wurden und deshalb auf den Pflichtteil angewiesen sind. Die Bezeichnung als „kleiner“ Pflichtteil ist dabei etwas irreführend, da der kleine Pflichtteil in diesem Fall dem normalen Pflichtteil entspricht.
Wie hoch ist der Pflichtteil des Ehegatten bei Gütertrennung?
Haben Sie in notarieller Form den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft aufgehoben und stattdessen Gütertrennung vereinbart, erben Sie als überlebender Ehegatte neben eventuell vorhandenen Kindern zu gleichen Teilen. Sind keine Kinder vorhanden, wären Sie Alleinerbe. Hat Sie Ihr Ehepartner jedoch enterbt, haben Sie Anspruch auf den Pflichtteil und erhalten jeweils die Hälfte Ihres dergestalt berechneten gesetzlichen Erbteils. Ein Ausgleich auf Zugewinn besteht nicht.
Auskunftsansprüche des Enterbten: Wie erfährt der Pflichtteilsberechtigte vom Inhalte und Wert des Nachlasses?
Woher weiß ich, dass der Erbe über den Nachlasswert korrekt informiert?
Sie können über das bloße Verzeichnis des Nachlasses hinaus auch verlangen, dass Sie an der Aufstellung des Verzeichnisses beteiligt werden. Zusätzlich können Sie fordern, dass eine Amtsperson, etwa ein Notar, hinzugezogen wird, der darüber wacht, dass das Verzeichnis ordnungsgemäß erstellt wird. Im Zweifel muss der Erbe das Verzeichnis ergänzen oder seine Vollständigkeit eidesstattlich versichern.
Ist der Nachlass schwer einzuschätzen, haben Sie Anspruch auf Wertermittlung durch einen Sachverständigen. Die Kosten trägt der Nachlass. Verbindlich ist das Gutachten allerdings nicht. Es versetzt Sie aber in die Lage, sich ein Bild über den Wert des Nachlasses zu machen. Danach können Sie entscheiden, ob Sie es auf einen Prozess ankommen lassen oder nicht. In letzter Konsequenz müssen Sie Auskunftsrecht und Pflichtteilsanspruch vor Gericht einklagen.
Sind Sie pflichtteilsberechtigt, lässt sich Ihr Pflichtteilsanspruch gegen den Alleinerben oder die Erbengemeinschaft nur berechnen, wenn Sie darüber informiert sind, was zum Nachlass gehört und welchen Wert der Nachlass hat. Zu diesem Zweck besteht ein gesetzlich verbriefter Auskunftsanspruch.
Berechnung des Pflichtteils: Wer muss bezahlen und wie hoch ist der Pflichtteilsanspruch?
Welchen Inhalt hat der Pflichtteilsanspruch?
Der Pflichtteil begründet keine Teilhabe am Nachlass. Als Pflichtteilsberechtigter haben Sie keinen Anspruch darauf, dass Sie am Nachlass beteiligt werden. Sie können nicht über Nachlasswerte verfügen und haben nichts zu bestimmen. Bestimmungsberechtigt ist allein der tatsächliche Erbe. Der Pflichtteil ist auf die Zahlung von Bargeld gerichtet. Alternativ kann der Erbe auch Vermögenswerte überlassen.
Lesen Sie meinen vertiefenden Ratgeber zu Berechnung Pflichtteil: Wer muss bezahlen und wieviel?

- Holen Sie sich Ihr Recht: Eine Enterbung ist in Deutschland nahezu unmöglich. Nur bei schweren Straftaten gegen den Erblasser oder einem notariellen Erbverzicht ist eine Enterbung möglich.
- Ohne Kostenrisiko: Mit Erbfinanz als Prozessfinanzierer brauchen Sie keine Angst vor wirtschaftlich stärkeren Erben haben – mein Partner trägt sämtliche Kosten des Rechtsstreits.
- Freie Anwaltswahl: Sie können sich Ihren Anwalt frei aussuchen – vorausgesetzt es ist ein Fachanwalt für Erbrecht. Gerne können Sie Erbfinanz auch nach Empfehlungen fragen.

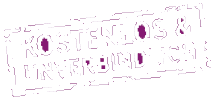
Wie berechne ich die Höhe meines Pflichtteils?
Um den Pflichtteilsanspruch zu berechnen, haben Sie gegenüber dem tatsächlichen Erben einen Auskunftsanspruch. Der Erbe ist verpflichtet, ein Verzeichnis der Nachlassgegenstände und Verbindlichkeiten zu überreichen. Auch Schenkungen des Erblassers während der letzten zehn Jahre und alle Schenkungen an den Ehegatten gehören dazu, ebenso ausgleichs- und anrechnungspflichtige Zuwendungen an andere Pflichtteilsberechtigte.
Welche Verbindlichkeiten kann der Erbe bei der Berechnung des Pflichtteils abziehen?
Ihr Pflichtteil ist abhängig davon, wie viele Person erbberechtigt sind und wie hoch der Nachlass ist. Der Nachlass berechnet sich nach den vorhandenen Vermögenswerten unter Berücksichtigung der Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten vermindern den Pflichtteilsanspruch.
- So darf der Erbe Geldschulden abziehen, die sich aus einem überzogenen Bankkonto, einer Darlehensschuld, nicht bezahlten Einkommensteuern oder Unterhaltsverpflichtungen ergeben
- Auch die Zugewinnausgleichsforderung des überlebenden Ehepartners ist abzuziehen
- Zu berücksichtigen sind ferner Kosten, die durch den Erbfall entstehen: Beerdigung, Kostenaufwand für die Grabstätte, nicht aber die laufende Grabpflege – erst in 2021 entschieden vom BGH: Grabpflegekosten sind keine Nachlassverbindlichkeiten
- Kosten zur Wertermittlung des Nachlasses
- Der Voraus des Ehegatten: Jeder überlebende Ehegatte erhält vorab und zusätzlich zu seinem Erbteil die zum gemeinsamen Haushalt gehörenden Gegenstände und das gemeinsam genutzte Familienauto als Voraus. Der Voraus mindert den Nachlass und damit den Pflichtteil.
Neben dem Auskunftsanspruch über den Inhalt des Nachlasses haben Sie auch einen Anspruch auf Ermittlung des Nachlasswertes, den sog. Wertermittlungsanspruch des Pflichtteilsberechtigten.
Pflichtteilsergänzungsanspruch: Ausgleich von lebzeitigen Schenkungen des Erblassers an Dritte
Diese Schenkungen werden bei der Pflichtteilsberechnung dem Nachlasswert hinzugerechnet, sofern sie innerhalb der letzten zehn Jahre vor dem Tod des Erblassers erfolgt sind. Der Wert, der dem Nachlass hinzugerechnet wird, sinkt pro Jahr um 10%. Hat also ein Erblasser vor 5 Jahren 100.000 € verschenkt, so wird der Nachlass für die Berechnung des Pflichtteils um 50.000 € erhöht. Bei Ehegatten gilt die Besonderheit, dass die 10-Jahres-Berechnung erst mit der Auflösung der Ehe beginnt, also Scheidung oder Tod eines Ehegatten.
Lesen Sie meinen vertiefenden Ratgeber zum Pflichtteilsergänzungsanspruch. Behandelt werden Fragen zu „In welchem Zeitraum werden Schenkungen berücksichtigt?“, „Wann genau beginnt die Zehnjahresfrist?“, „Unbenannten Zuwendungen: Schenkungen an den Ehepartner“ … und vieles mehr!
Enterbung: Wann besteht kein Anspruch auf den Pflichtteil
Wann bin ich vom Pflichtteil ausgeschlossen?
Es gibt besondere Situationen, in denen das Pflichtteilsrecht ausgeschlossen ist.
- Verlust des Erbrechts: hat der gesetzliche Erbe sein Erbrecht verloren, so ist es auch konsequent sein Pflichtteilsrecht auszuschließen. Hierunter fallen die beiden Fälle der Erbunwürdigkeit und des Erbverzichts. Die Erbunwürdigkeit bestimmt sich nach § 2339 BGB. Insbesondere die Tötung oder versuchte Tötung des Erblassers sowie die Verhinderung des Erblassers an der Errichtung eines Testaments fallen hierunter.
- Entziehung des Pflichteils: Der Erblasser ist berechtigt, einen gesetzlichen Erben in bestimmten Situationen vom Erbe auszuschließen. Diese Gründe sind abschließend in § 2333 BGB geregelt und betreffen allesamt besonders schwere Verfehlungen gegen den Erblasser, seinen Ehegatten oder eine andere dem Erblasser nahestehende Person. Hierunter fällt, neben dem obligatorischen „trachten nach dem Leben“ vor allem die Verletzung der gesetzlich obliegenden Unterhaltspflicht.
- Zuletzt benennt das Gesetz noch die Beschränkung in guter Absicht: Lebt ein Abkömmling verschwenderisch oder ist er verschuldet, so kann der Erblasser bestimmen, dass der ihm gebührende Pflichtteil auf dessen Abkömmlinge im Wege der Nacherbschaft übertragen wird.
Können Enkel den Pflichtteil einfordern, wenn dem Elternteil der Pflichtteil entzogen wurde?
Der Erblasser kann einem gesetzlichen Erben testamentarisch den Pflichtteil entziehen, wenn der Erbe sich einer schwerwiegenden Verfehlung schuldig gemacht hat. Die dafür maßgeblichen Gründe sind in § 2333 BGB formuliert. Im Zweifel geht der Entzug des Pflichtteils auch zulasten der Enkel. Dann erbt auch der Enkel nichts.
Im Fall der Vermögensverschwendung oder Überschuldung des Elternteils, kann der Erblasser das Pflichtteilsrecht des Elternteils auch derart beschränken, dass der pflichtteilsberechtigte Elternteil Vorerbe wird und nach dessen Tod das Enkelkind den Pflichtteil als Nacherbe erhalten soll. Dann verbleiben dem Elternteil die Einkünfte aus dem hinterlassenen Vermögen, er kann aber nicht selbst über das Vermögen verfügen. Die Entziehung des Pflichtteils wird jedoch unwirksam, wenn der Erblasser die Verfehlung verziehen hat.
Wann greift die Pflichtteilsstrafklausel?
Ehepartner setzen sich oft testamentarisch oder in einem Erbvertrag zum gegenseitigen Alleinerben des zuerst versterbenden Ehepartners ein. Um zu verhindern, dass ein dadurch von der Erbschaft zunächst ausgeschlossener Abkömmling vorzeitig den Pflichtteil geltend macht, vereinbaren die Ehepartner oft eine Pflichtteilsstrafklausel.
Wenn Sie als Abkömmling nach dem Ableben eines Elternteils vom überlebenden Elternteil Ihren Pflichtteil einfordern, bekommen Sie auch nach dem Tode des überlebenden Elternteils gleichfalls nur noch den Pflichtteil. Dafür genügt es, dass Sie den Pflichtteil nach dem ersten Erbfall einfordern. Es kommt nicht darauf an, ob Ihnen der Pflichtteil auch ausgezahlt wird. Es genügt allein Ihre Forderung, den Pflichtteil ausgezahlt zu bekommen und Sie den überlebenden Elternteil dadurch unter Druck setzen.
Pflichtteil einfordern: Welche Schritte, Fristen und formalen Anforderungen sind zu beachten?
Rechtliche Schritte um den Pflichtteil einzufordern
Als pflichtteilsberechtigter Erbe müssen Sie Ihren Pflichtteilsanspruch gegenüber dem in einem Testament oder einem Erbvertrag bestimmten Erben geltend machen. Auf eine besondere Form kommt es dabei nicht an. Es empfiehlt sich aber, den Anspruch schriftlich geltend zu machen.

- Holen Sie sich Ihr Recht: Eine Enterbung ist in Deutschland nahezu unmöglich. Nur bei schweren Straftaten gegen den Erblasser oder einem notariellen Erbverzicht ist eine Enterbung möglich.
- Ohne Kostenrisiko: Mit Erbfinanz als Prozessfinanzierer brauchen Sie keine Angst vor wirtschaftlich stärkeren Erben haben – mein Partner trägt sämtliche Kosten des Rechtsstreits.
- Freie Anwaltswahl: Sie können sich Ihren Anwalt frei aussuchen – vorausgesetzt es ist ein Fachanwalt für Erbrecht. Gerne können Sie Erbfinanz auch nach Empfehlungen fragen.

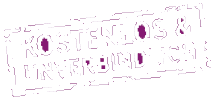
Wann ist der Pflichtteilsanspruch fällig?
Der Anspruch auf den Pflichtteil entsteht mit dem Erbfall. Sie können also in dem Augenblick, in dem Ihr Angehöriger verstorben ist, den Pflichtteilsanspruch gegenüber dem Erben geltend machen. Voraussetzung ist, dass Sie sicher wissen, dass Sie als gesetzlicher Erbe enterbt wurden, dadurch Ihr Pflichtteilsrecht begründet ist und der tatsächliche Erbe feststeht. Dennoch sollten Sie nichts überstürzen und gewissenhaft die Voraussetzungen Ihres Anspruchs prüfen.
Kann der Pflichtteilsanspruch gestundet werden?
Machen Sie Ihren Pflichtteilsanspruch sofort gelten, können Sie den Erben in Bedrängnis bringen, wenn er zum Nachlass gehörende Vermögenswerte sofort veräußern müsste oder Vermögenswerte nicht sofort veräußert werden können. Um diesen Risiken vorzubeugen, darf der Erbe die Stundung des Pflichtteilsanspruchs verlangen oder Ratenzahlungen anbieten, wenn dessen sofortige Erfüllung ungewöhnlich harte Konsequenzen hätte. Dabei sind die beiderseitigen Interessen gegeneinander abzuwägen. Notfalls entscheidet das Nachlassgericht über die Stundung.
Wie lange kann ich den Pflichtteil geltend machen? Wann verjährt der Pflichtteilsanspruch?
Der Pflichtteilsanspruch unterliegt der Verjährung. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre. Die Frist beginnt aber erst am Ende des Jahres zu laufen, in dem der Erbfall eingetreten ist.
Sind die Erben zunächst unbekannt oder haben Sie keine Kenntnis von Ihrem Pflichtteilsanspruch, haben Sie theoretisch 30 Jahre Zeit, Ihre Ansprüche geltend zu machen. Sobald Sie jedoch Kenntnis erlangen, beginnt die Verjährungsfrist von drei Jahren zu laufen. Um die Verjährung zu unterbrechen, genügt die Aufforderung zur Zahlung oder zur Anerkennung des Pflichtteilsanspruchs nicht. Vielmehr müssen Sie den Anspruch gerichtlich geltend machen oder die Erklärung des Erben verlangen, dass er den Pflichtteilsanspruch anerkennt.
Wie machen Sie den Pflichtteilsanspruch geltend? Was sind die häufigsten Streitfälle im Pflichtteilsrecht? Welche Möglichkeiten der außergerichtlichen Streitbeilegung und der Mediation gibt es? Dies und vieles mehr zu Pflichtteil einfordern.
Steuerliche Aspekte des Pflichtteils: Wie hoch sind Erbschaftsteuer, Freibeträge und Steuersätze?
Auch wenn Sie den Pflichtteilsanspruch geltend machen, erben Sie Vermögenswerte. Ihr Pflichtteil unterliegt damit der Erbschaftssteuer. Voraussetzung ist jedoch, dass Sie den Anspruch geltend machen und den Pflichtteil ausgezahlt bekommen. Angehörige profitieren jedoch von hohen Freibeträgen. Erst Vermögenswerte, die über die Freibeträge hinausgehen, unterliegen der Steuerpflicht. Der Freibetrag beträgt für: …
- Ehepartner und Lebenspartner 500.000 €
- Kinder und Stiefkinder 400.000 €
- Enkelkinder, deren Elternteil verstorben ist 400.000 €
- alle anderen Enkel 200.000 €
- Eltern und Großeltern 200.000 €
- Geschwister, Nichten, Neffen, geschiedene Ehepartner 20.000 €
- alle übrigen Erben 20.000 €
Nicht ausreichend bedachter Pflichtteilsberechtigter oder Erbe: Welche Optionen bestehen?
Ein Pflichtteilsberechtiger wird zwar Erbe, aber erbt weniger als seinen Pflichtteil
Für diesen Fall steht ihm der Zusatzpflichtteilsanspruch nach § 2305 BGB zu. Hiernach kann er die Differenz zum Pflichtteilsanspruch gegenüber der Erbengemeinschaft geltend machen.
Was ist der Zusatzpflichtteil?
Hat Sie der Erblasser im Testament zwar bedacht, bleibt das, was hinterlassen wurde aber wertmäßig unterhalb Ihrer Pflichtteilsquote, sind Sie faktisch zumindest teilweise enterbt. Sie haben dann gegen den Erben einen Anspruch auf Auszahlung des Zusatzpflichtteils. Dazu müssen Sie die Erbschaft annehmen und werden Erbe, können aber zusätzlich von den Miterben den Ausgleichsbetrag bis zur Höhe Ihres Pflichtteils verlangen. Der Zusatzpflichtteil ist ein reiner Geldanspruch gegen die Erben. In Höhe Ihres gesetzlichen Erbteils sind Sie jedoch gleichberechtigter Miterbe. Sie behalten den Anspruch auf den Zusatzpflichtteil auch dann, wenn Sie die übrige Erbschaft ausschlagen.






