Immobilienverrentung Nachlassplanung: Modelle & Vorteile

Zuletzt aktualisiert:
Ihre Lesezeit:
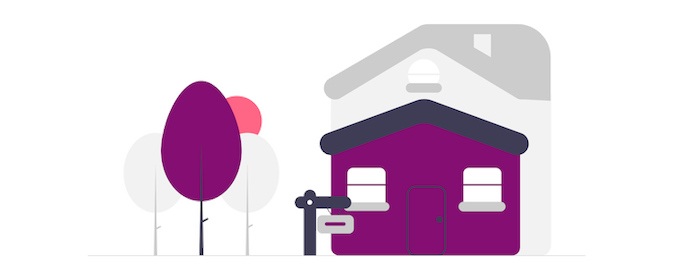
Immobilienverrentung Nachlassplanung
- Zwei Grundprinzipien: Entweder wird Eigentum gegen regelmäßige Zahlungen oder eine Einmalleistung veräußert und ein dinglich gesichertes Nutzungsrecht eingeräumt, oder es wird ein kreditbasiertes Produkt aufgenommen, bei dem das Eigentum erhalten bleibt und die Schuld bis zum Ausfall wächst. Diese Grundentscheidung bestimmt unmittelbar, ob Erben später Eigentum übernehmen oder Schulden tilgen müssen und beeinflusst Liquidität, Risiko und steuerliche Folgen.
- Rechtssicherheit zuerst: Notarielle Verträge und die Eintragung von Wohnrecht oder Nießbrauch an erster Rangstelle im Grundbuch sind entscheidend, damit das Bleiberecht gegenüber späteren Gläubigern geschützt ist. Fehlt diese Vorrangstellung, kann bei Insolvenz oder Zwangsversteigerung das Nutzungsrecht verloren gehen; deshalb sollten Rang, Rentengarantie und Rückkaufsregelungen klar und geprüft vereinbart werden.
- Liquidität vs. Erbenlasten: Verkaufsbasierte Lösungen bieten planbare Auszahlungen ohne wachsende Verschuldung, während darlehensbasierte Modelle Eigentum erhalten, aber durch Zinseszins die Nachlassmasse reduzieren können. Wählen Sie je nach sofortigem Kapitalbedarf, Bleibewunsch und dem Willen der Erben zur Rückzahlung; ein konkretes Beispiel ist die lebenslange Rentenzahlung gegenüber einer Umkehrhypothek mit endfälliger Rückzahlung.

Inhaltsverzeichnis
- Modelle der Immobilienverrentung für die Nachlassplanung
- Leibrente in der Nachlassplanung nutzen
- Wohnrecht und Nießbrauch rechtlich absichern
- Umkehrhypothek und Immobilienkredit im Vergleich
- Immobilienrente und Nießbrauchwert berechnen
- Rückmietverkauf in der Nachlassplanung nutzen
- Steuern, Pflichtteil und Erben berücksichtigen
- Immobilienverrentung erfolgreich umsetzen
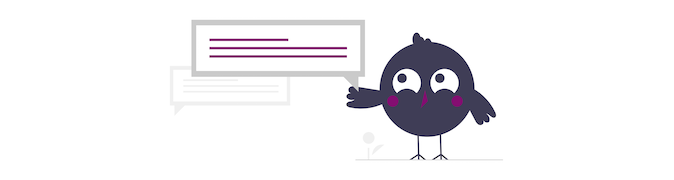
Herbert | HEREDITAS » Erb-Assistent
- Ihr digitaler Assistent für individuelle Fragen und verständliche Informationen. Die KI wertet alle Inhalte der Webseite aus und erklärt komplexe Themen einfach.
- Keine Anmeldung erforderlich.
- Kostenlos im Browser.



Modelle der Immobilienverrentung für die Nachlassplanung
Immobilienverrentung ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Gestaltungsmodelle, bei denen Immobilieneigentum gegen regelmäßige Zahlungen, Einmalbeträge oder Kredite liquidiert wird – ohne dass die Bewohner sofort ausziehen müssen. Für die Nachlassplanung eröffnet dies Gestaltungsspielräume: etwa zur Reduktion des Pflichtteils, zur Steueroptimierung, zur Pflegefinanzierung oder zur lebzeitigen Schenkung.
Die Verrentungsmodelle lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen:
- Verkaufsbasierte Modelle mit Eigentumsübertragung und
- Darlehensbasierte Modelle, bei denen das Eigentum erhalten bleibt.
Im Folgenden stelle ich die gängigen Varianten mit ihren rechtlichen und finanziellen Besonderheiten dar.
Leibrente: Verkauf gegen monatliche Zahlung und Wohnrecht
Die Leibrente ist ein Klassiker: Die Immobilie wird vollständig verkauft. Als Gegenleistung erhält der Verkäufer eine lebenslange monatliche Zahlung – oft ergänzt durch eine Einmalzahlung. Der Verkäufer bleibt in der Immobilie wohnen, meist durch ein grundbuchlich gesichertes Wohnrecht oder Nießbrauchrecht. Stirbt er vorzeitig, endet die Rente; bei Rentengarantie profitieren die Erben.
- Vorteile: Planbare Zahlung bis Lebensende, gesichertes Wohnrecht, klare Eigentumslage.
- Nachteile: Kein Rückkaufsrecht, keine Restnutzung durch Erben.
- Typische Zielgruppe: Senioren mit hohem Bleibewunsch und Versorgungslücke.
Teilverkauf: Kapital durch Anteilserwerb mit Nutzungsentgelt
Beim Teilverkauf veräußert der Eigentümer einen Anteil der Immobilie – meist 20 bis 50 Prozent – an einen Dritten. Die Nutzung bleibt vollständig beim Verkäufer. Dafür zahlt er ein monatliches Nutzungsentgelt für den verkauften Anteil. Der Eigentümer behält einen Restanteil, den er vererben kann; außerdem kann ihm vertraglich eine Rückkaufoption für den verkauften Anteil eingeräumt werden (oft auch vererbbar).
- Vorteile: Flexibler Kapitalzugang, Erhalt des Miteigentums, Rückkaufoption.
- Nachteile: Laufendes Entgelt, Bindung an Investor, mögliche Interessenkonflikte.
- Typische Zielgruppe: Eigentümer mit moderatem Kapitalbedarf und Rückkaufsabsicht.
Nießbrauchlösung: Übertragen, aber Nutzung behalten
Bei der Nießbrauchlösung wird die Immobilie an Kinder oder Dritte übertragen, während der Übertragende sich ein lebenslanges Nießbrauchrecht vorbehält. Er darf darin wohnen oder vermieten. Das Eigentum geht damit aus dem Nachlass. Der steuerlich anzusetzende Wert reduziert sich um den Kapitalwert des Nießbrauchs – was Freibeträge schont und die Pflichtteilsmasse reduziert. Je nach Zeitpunkt und Umfang der Nutzung bleibt die Übertragung pflichtteils- oder steuerlich relevant.
- Vorteile: Steuervorteil durch Wertabschlag, lebzeitige Gestaltung, Erhalt von Nutzung und Kontrolle.
- Nachteile: Kein Rückgriff auf Immobilie, Frist für Pflichtteilsrelevanz läuft meist nicht an.
- Typische Zielgruppe: Eltern mit Schenkungswunsch und starkem Wunsch nach Bleiberecht.
Rückmietverkauf: Verkauf mit sofortiger Auszahlung, Nutzung als Mieter
Beim Rückmietverkauf wird die Immobilie vollständig verkauft – meist zu Marktwert – und der Verkäufer schließt einen unbefristeten Mietvertrag mit Ausschluss der Eigenbedarfskündigung über die weitere Nutzung ab. Es gilt normales Mietrecht (§ 535 BGB). Die Miete muss regelmäßig gezahlt werden. Der Vorteil ist maximale Sofortauszahlung, der Nachteil ist das fehlende dinglich gesicherte Bleiberecht wie bei einem grundbuchlich gesicherten Wohnrecht.
- Vorteile: Maximale Liquidität, keine Rentenverpflichtung, steuerlich klar.
- Nachteile: Mietkostenbelastung, kein dinglich gesichertes Bleiberecht wie bei einem grundbuchlich gesicherten Wohnrecht.
- Typische Zielgruppe: Kapitalbedarf z. B. für Heimunterbringung oder Schenkungen, ohne Bleibewunsch bis ans Lebensende.
Darlehensbasierte Modelle: Umkehrhypothek und Seniorendarlehen
Bei darlehensbasierten Modellen bleibt das Eigentum vollständig erhalten. Der Eigentümer nimmt ein Darlehen auf Basis des Immobilienwerts auf. Die Rückzahlung erfolgt erst beim Tod oder Auszug. Je nach Modell erfolgt die Auszahlung als Rente, Kreditlinie oder Einmalbetrag. Die Belastung wächst durch Zinseszinseffekt.
- Vorteile: Eigentum bleibt erhalten, hohe Flexibilität, spätere Entscheidung möglich.
- Nachteile: Zinsbelastung wächst, Erben müssen Darlehen tilgen oder Immobilie verkaufen.
- Typische Zielgruppe: Eigentümer mit Rückkaufswunsch in der Familie oder Eigentumserhalt als Ziel.
Sie haben ein rechtliches Anliegen zum Erben und Vererben?*

- Soforthilfe bei Rechtsfragen: Ihre Situation, Chancen und Risiken
- Beratung durch erfahrene Anwälte & Rechtsexperten
- Ortsunabhängig, einfach und digital
Leibrente in der Nachlassplanung nutzen
Die Leibrente ist das bekannteste Modell der Immobilienverrentung: Der Eigentümer verkauft seine Immobilie gegen eine lebenslange Rentenzahlung, behält aber ein Wohnrecht oder Nießbrauchrecht. In der Nachlassplanung kann die Leibrente gezielt eingesetzt werden, um Versorgung im Alter sicherzustellen, Pflichtteilsansprüche zu reduzieren oder durch monatliche Zahlungen und Einmalbeträge Schenkungen zu Lebzeiten zu ermöglichen.
Typische Zielgruppen sind alleinstehende oder kinderlose Eigentümer, Senioren mit Pflegebedarf oder Personen mit Liquiditätswunsch, die im Haus bleiben möchten. Auch für Menschen mit niedriger Rente und werter Immobilie ist die Leibrente eine strategische Option. Im Vergleich zu anderen Verrentungsmodellen ist sie zivilrechtlich klar geregelt und wird notariell gestaltet, was ein hohes Maß an Rechtssicherheit bietet.
Auszahlung als Leibrente, Zeitrente oder Einmalbetrag
Die klassische Leibrente besteht aus einer monatlichen Zahlung auf Lebenszeit. Je nach Anbieter und Vertrag kann sie auch als befristete Zeitrente ausgestaltet werden – etwa für zehn oder zwanzig Jahre. Alternativ oder ergänzend ist eine Einmalzahlung zu Vertragsbeginn üblich. Dadurch lassen sich z. B. Umbaukosten, Pflege oder Schulden tilgen. Die konkrete Ausgestaltung beeinflusst Höhe, Steuerwirkung und Flexibilität der Vereinbarung.
- Lebenslange Rente: Zahlung bis zum Tod, Höhe abhängig vom Alter und Verkehrswert der Immobilie.
- Zeitrente: Befristete Rentenzahlung, z. B. für 15 Jahre. Geeignet für Senioren mit zusätzlicher Altersvorsorge.
- Kombination: Einmalzahlung + Rente. Für sofortigen Kapitalbedarf und langfristige Versorgung.
Vertragliche Absicherung: Wohnrecht, Nießbrauch, Rentengarantie
Die rechtliche Gestaltung entscheidet über Sicherheit und Nachlasswirkung der Leibrente. Standard ist ein grundbuchlich gesichertes Wohnrecht nach § 1093 BGB. Alternativ kann ein Nießbrauchrecht vereinbart werden, das auch die Vermietung ermöglicht. Beide Rechte sollten an erster Rangstelle im Grundbuch eingetragen werden, um Vorrang vor anderen Belastungen zu sichern.
Ergänzend kann eine Rentengarantiezeit vereinbart werden. Sie stellt sicher, dass die Rentenzahlungen auch im Todesfall für einen festgelegten Zeitraum weiter an die Erben gehen. Dies ist besonders bei frühzeitigem Versterben des Rentenempfängers relevant.
- Wohnrecht: Eigenes Nutzungsrecht. Erlischt mit Tod oder Aufgabe. Keine Vermietung erlaubt.
- Nießbrauch: Umfassendes Nutzungsrecht, inklusive Vermietung. Höherer Wertabschlag bei Verkauf.
- Rentengarantie: Auszahlung z. B. für mindestens 10 Jahre, auch bei frühem Tod des Berechtigten.
Die Leibrente verbindet Sicherheit mit planbarer Liquidität. Gerade für Personen ohne Erben oder mit geringer Rente ist sie ein wirkungsvolles Instrument der Alters- und Nachlassplanung.
E-Book: „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“
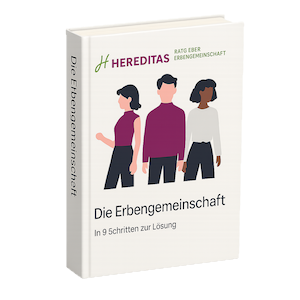
- Gratis-E-Book „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“: Mein Leitfaden, wie Sie Ihren Weg aus der Erbengemeinschaft finden. Exklusive und kostenfreie Zugabe zum Newsletter!
- Checkliste Todesfall: Die wichtigsten Aufgaben für Angehörige in den ersten Tagen und Wochen nach dem Todesfall. Ebenfalls kostenlos zum Newsletter!
- Der Newsletter: Nichts mehr verpassen. Meine exklusiven Insider-Tipps, neueste Beiträge und aktuelle Entwicklungen!
Wohnrecht und Nießbrauch rechtlich absichern
Wer seine Immobilie verrentet, will meist weiter darin wohnen bleiben. Zwei rechtliche Instrumente sichern dieses Bleiberecht: das Wohnrecht nach § 1093 BGB und der Nießbrauch nach §§ 1030 ff. BGB. Beide müssen notariell vereinbart und im Grundbuch eingetragen werden, unterscheiden sich jedoch in Nutzungsumfang, steuerlicher Wirkung und Konsequenzen für den Nachlass.
In der Nachlassplanung beeinflussen Wohnrecht und Nießbrauch sowohl den Wert des übertragenen Vermögens als auch die Pflichtteils- und Steuerberechnung. Daher sollten sie nicht nur aus wohnpraktischer Sicht, sondern auch im Hinblick auf Erben und Gestaltungsspielräume bewusst gewählt werden.
Unterschiede zwischen Wohnrecht und Nießbrauch
Ein Wohnrecht erlaubt es dem Berechtigten, die Immobilie oder einen Teil davon persönlich zu nutzen – eine Vermietung ist ausgeschlossen. Es erlischt mit dem Tod oder Verzicht. Der Nießbrauch hingegen ist umfassender: Er erlaubt auch die Vermietung, Verpachtung und das Ziehen aller wirtschaftlichen Nutzungen. Beide Rechte sind nicht übertragbar und höchstpersönlich, unterscheiden sich aber im Wert und in der Flexibilität für den Berechtigten.
- Wohnrecht: Nur Eigenbedarf erlaubt. Kein Anspruch auf Mieteinnahmen. Steuerlich geringer bewertet.
- Nießbrauch: Nutzung wie ein Eigentümer – inklusive Vermietung. Steuerlich höherer Gegenwert.
Eintragung im Grundbuch: Erste Rangstelle entscheidend
Ein Wohnrecht oder Nießbrauch entfaltet nur dann vollen Schutz, wenn es an erster Rangstelle in Abteilung II des Grundbuchs eingetragen ist. Andernfalls können spätere Gläubiger – etwa Banken bei Finanzierung des Käufers – Vorrang erlangen. Das kann im Fall von Insolvenz oder Zwangsversteigerung zu einem Verlust des Nutzungsrechts führen.
Die Eintragung erfolgt notariell und wird im Kauf- oder Übertragungsvertrag geregelt. Wichtig ist, dass alle Beteiligten den Rangverzicht zugunsten des Wohn- oder Nießbrauchrechts akzeptieren. Ohne diese Absicherung kann die gesamte Verrentungslösung kippen.
Nutzungsentgelt beim Teilverkauf
Beim Teilverkauf wird ein Anteil der Immobilie veräußert – meist zwischen 20 % und 50 %. Der Verkäufer bleibt wirtschaftlich Alleinnutzer, zahlt jedoch ein monatliches Nutzungsentgelt an den neuen Miteigentümer. Dieses Entgelt ist vergleichbar mit einer anteiligen Miete und liegt häufig zwischen 3 % und 5 % des Auszahlungsbetrags pro Jahr. Die Zahlungspflicht endet in der Regel mit dem Tod des Verkäufers.
Die genaue Höhe hängt von Immobilientyp, Region und Anbieter ab. Sie wird vertraglich fixiert oder indexiert (z. B. an den Verbraucherpreisindex gekoppelt). Auch Kündigungsrechte, Sonderzahlungen oder Kaufoptionen sollten geregelt sein.
- Entgeltformel: z. B. 4 % p. a. auf Auszahlungswert von 100.000 € = 333 € monatlich.
- Laufzeit: bis Tod oder Rückkauf der Anteile.
- Veränderbarkeit: Indexklauseln möglich. Ggf. an Inflation gebunden.
Wohnrecht und Nießbrauch sind tragende Säulen jeder Verrentungsvereinbarung. Sie sichern nicht nur das Bleiberecht, sondern beeinflussen Steuer, Pflichtteil und Vertragswert.
Vereinbaren Sie vor Vertragsabschluss notariell ein grundbuchlich gesichertes Wohnrecht oder Nießbrauch an erster Rangstelle, sonst kann Ihr Bleiberecht bei späterer Finanzierung oder Insolvenz verloren gehen. Holen Sie ein unabhängiges Verkehrswertgutachten sowie eine steuer‑ und erbrechtliche Prüfung ein und vergleichen Sie mehrere Angebote (Leibrente, Teilverkauf, Umkehrhypothek) bezüglich Auszahlung, Kosten, Rückkaufs‑ und Erbenfolgen.

Persönlicher Experten-Tipp von Dr. Stephan Seitz
Umkehrhypothek und Immobilienkredit im Vergleich
Wer seine Immobilie nicht verkaufen möchte, aber dennoch Kapital für Alter, Pflege oder Schenkungen benötigt, kann sie beleihen. Die Umkehrhypothek ist ein spezielles Finanzierungsmodell für Senioren: Sie erlaubt Auszahlungen auf Basis des Immobilienwerts, ohne dass das Objekt verkauft werden muss. Eine Alternative dazu ist das tilgungsfreie Seniorendarlehen. Beide Modelle bringen Liquidität im Alter – und Schulden im Erbfall.
In der Nachlassplanung spielen diese Modelle eine besondere Rolle: Sie erhalten das Eigentum zu Lebzeiten, verschieben die finanzielle Belastung aber in die Zukunft. Dadurch bleibt Gestaltungsspielraum, etwa für einen späteren Verkauf oder für Erben, die die Immobilie übernehmen möchten.
Funktionsweise und Beleihungswert
Bei einer Umkehrhypothek (auch: Reverse Mortgage) wird eine Grundschuld auf die Immobilie eingetragen. Im Gegenzug zahlt die Bank eine monatliche Rente, eine Einmalzahlung oder stellt einen Kreditrahmen zur Verfügung. Das Besondere: Während der Laufzeit müssen weder Zinsen noch Tilgung gezahlt werden. Die Schuld wächst durch Zinseszinseffekt.
Der maximale Darlehensbetrag hängt vom Verkehrswert, dem Alter des Eigentümerpaares und vom Beleihungswert ab. Banken kalkulieren konservativ – ältere Kreditnehmer erhalten höhere Auszahlungen, da ihre statistische Lebenserwartung geringer ist.
- Verkehrswert: Aktueller Marktwert laut Gutachten oder Bankeinschätzung.
- Beleihungsauslauf: Maximal 40 – 50 % des Verkehrswerts, je nach Alter und Anbieter.
- Auszahlungsform: Einmalbetrag, monatlich oder Abrufkredit.
Rückzahlung bei Tod: Optionen der Erben
Die Umkehrhypothek ist endfällig: Die Schuld muss nach dem Tod oder Auszug des Kreditnehmers zurückgezahlt werden. Meist erfolgt dies durch Verkauf der Immobilie. Alternativ können die Erben das Darlehen aus eigenen Mitteln ablösen, um das Haus zu behalten.
Ein zentraler Punkt ist die Nachschusspflicht: Bei seriösen Anbietern ist die Haftung der Erben auf den Immobilienwert begrenzt. Reicht der Verkaufserlös nicht zur Tilgung, übernimmt die Bank das Risiko. Dennoch kann ein großer Teil des Erbes durch die aufgelaufenen Schulden verloren gehen.
- Option 1: Immobilie verkaufen, Bank auszahlen, Rest behalten.
- Option 2: Immobilie behalten, Darlehen ablösen (z. B. durch neues Hypothekendarlehen).
- Option 3: Erbe ausschlagen, falls Nachlass insgesamt negativ.
Vergleich zu Verkaufsmodellen
Die Umkehrhypothek ermöglicht es, Eigentum und Kontrolle über die Immobilie zu behalten. Der Eigentümer bleibt im Grundbuch und kann theoretisch jederzeit den Kredit zurückzahlen oder die Immobilie verkaufen. Das schafft Flexibilität, bringt aber laufende Schulden mit sich.
Im Vergleich dazu führen Leibrente oder Teilverkauf zu einem unmittelbaren Eigentumsverlust (ganz oder anteilig), bieten dafür aber planbare Leistungen und keine wachsende Verschuldung. Die Entscheidung hängt davon ab, ob Eigentum gewünscht ist, wie hoch der Finanzbedarf ist und wie stark Erben beteiligt werden sollen.
- Umkehrhypothek: Eigentum bleibt, Schulden wachsen, spätere Tilgung erforderlich.
- Leibrente: Immobilie verkauft, Zahlung lebenslang, kein Kredit, aber Eigentumsverlust.
- Teilverkauf: Anteil verkaufen, Nutzungsentgelt zahlen, Miteigentum mit Investor.
Wer seine Immobilie nutzen will, ohne sie aufzugeben, findet in der Umkehrhypothek eine flexible, aber komplexe Lösung.
 Immobilienverrentung Nachlassplanung: Meine weiteren Artikel
Immobilienverrentung Nachlassplanung: Meine weiteren Artikel
 Nachlassplanung Pflichtteil: Pflichtteil gezielt reduzierenAutor: Dr. Stephan Seitz
Nachlassplanung Pflichtteil: Pflichtteil gezielt reduzierenAutor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 10. Oktober 2025 Übertragung Immobilie Lebzeiten: darum ist es so wichtig!Autor: Dr. Stephan Seitz
Übertragung Immobilie Lebzeiten: darum ist es so wichtig!Autor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 15. Oktober 2025 Nachlassplanung: Einfache Vorsorge für den Erbfall!Autor: Dr. Stephan Seitz
Nachlassplanung: Einfache Vorsorge für den Erbfall!Autor: Dr. Stephan Seitz
Zuletzt aktualisiert: 15. Oktober 2025
Immobilienrente und Nießbrauchwert berechnen
Wer eine Immobilie verrenten möchte, sollte wissen, wie viel sie monatlich einbringen kann. Entscheidend ist dabei nicht nur der Marktwert der Immobilie, sondern auch das Alter der berechtigten Person, die Vertragsgestaltung und eventuelle Rechte wie Nießbrauch oder Wohnrecht. Dieses Kapitel zeigt, wie die Immobilienrente und der Nießbrauchwert berechnet werden und warum diese Werte für die Nachlassplanung so entscheidend sind.
Die Berechnung beeinflusst nicht nur die monatliche Rente oder Einmalzahlung, sondern auch steuerliche Aspekte wie den Ertragsanteil oder die Schenkungs-/Erbschaftsteuer. Eine transparente Kalkulation ist daher für Eigentümer, Erben und Berater gleichermaßen zentral.
Thema vertiefen? Hier gibt es alle Details zur Immobilienbewertung!
Erfahren Sie, welche Stellen (Finanzamt, öffentlich bestellte Gutachter, Makler oder Online‑Tools) Immobilien bewerten, welche Verfahren (Vergleichs-, Sach‑, Ertragswert) angewendet werden und wie unterschiedlich diese Einschätzungen Erbschaftsteuer, Auszahlung an Miterben oder sogar das Risiko einer Teilungsversteigerung beeinflussen können. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wann ein unabhängiges Marktwertgutachten bares Geld spart, welche Fristen und Freibeträge Sie kennen müssen und wie Sie Streit sowie teure Bewertungsfehler vermeiden.
Immobilienrente: Verkehrswert, Alter, Rentenfaktor
Die Höhe der Leibrente ergibt sich aus dem Verkehrswert der Immobilie, dem Alter des Rentenempfängers und einem sogenannten Leibrentenfaktor. Dieser basiert auf der statistischen Lebenserwartung laut Sterbetafel sowie einem festgelegten Rechenzins. Anbieter ziehen Sicherheitsabschläge und Verwaltungskosten ab. Das Ergebnis ist die monatliche Zahlung, die der Eigentümer bis zum Lebensende erhält.
- Verkehrswert: Marktwert der Immobilie laut Gutachten oder Anbieterbewertung.
- Alter: Je höher, desto kürzer statistische Laufzeit → höhere Monatsrente.
- Rentenfaktor: Kapitalwertfaktor auf Basis der Lebenserwartung und Zinssatz.
Nießbrauchwert: Jahresmiete und Sterbetafel
Wird eine Immobilie verschenkt oder verkauft, aber der Nießbrauch vorbehalten, reduziert sich der steuerlich relevante Wert. Der Kapitalwert des Nießbrauchs wird anhand der fiktiven Jahresnettomiete und eines Vervielfältigers (Kapitalisierungsfaktor) berechnet. Dieser Faktor ergibt sich aus der Lebenserwartung laut Sterbetafel und einem gesetzlich vorgegebenen Zinssatz nach § 14 BewG.
- Jahresmiete: Fiktive ortsübliche Nettokaltmiete.
- Faktor: z. B. bei 76 Jahren etwa 10,0 → Kapitalwert = 10 × Jahresmiete.
- Wertminderung: Dieser Wert wird vom Verkehrswert abgezogen.
Renten- und Nießbrauchwert bestimmen die wirtschaftliche Machbarkeit jeder Verrentungslösung.
Sie haben ein rechtliches Anliegen zum Erben und Vererben?*

- Soforthilfe bei Rechtsfragen: Ihre Situation, Chancen und Risiken
- Beratung durch erfahrene Anwälte & Rechtsexperten
- Ortsunabhängig, einfach und digital
Rückmietverkauf in der Nachlassplanung nutzen
Der Rückmietverkauf kombiniert den vollständigen Verkauf der Immobilie mit einem langfristigen Mietvertrag. Der Eigentümer erhält den Kaufpreis sofort ausgezahlt, bleibt aber aufgrund eines Mietvertrags weiterhin im Haus oder in der Wohnung. Anders als bei der Leibrente gibt es keine monatliche Rentenzahlung, sondern reguläre Mietkosten – rechtlich gilt normales Mietrecht nach § 535 BGB.
Für die Nachlassplanung ist der Rückmietverkauf dann interessant, wenn kurzfristig viel Kapital benötigt wird, der Bleibewunsch aber nur für eine gewisse Zeit besteht oder ein späterer Umzug – etwa in ein Pflegeheim – ohnehin eingeplant ist.
Funktionsweise: Verkauf mit Mietvertrag und Eigenbedarfsausschluss
Beim Rückmietverkauf wird die Immobilie zum Marktpreis oder einem vereinbarten Kaufpreis verkauft. Parallel schließen Verkäufer und Käufer einen Mietvertrag, der die weitere Nutzung regelt. Üblich sind:
- Unbefristeter Mietvertrag mit Kündigungsverzicht durch den Käufer für einen längeren Zeitraum.
- Ausschluss der Eigenbedarfskündigung, damit der Verkäufer nicht wegen Eigenbedarf des Käufers ausziehen muss.
- Indexierte Miete, z. B. gekoppelt an den Verbraucherpreisindex.
Vorteile und Risiken gegenüber Leibrente und Umkehrhypothek
Im Vergleich zu anderen Verrentungsmodellen hat der Rückmietverkauf klare Stärken – aber auch typische Fallstricke:
- Vorteile: Maximale Sofortliquidität, klare Eigentumsverhältnisse, kein Kredit, transparente Miete statt komplexer Rentenberechnung.
- Nachteile: Mietkostenbelastung im Alter, kein dinglich gesichertes Wohnrecht, Risiko bei Käuferwechsel, Insolvenz oder Streit über Mieterhöhungen.
- Vergleich zur Leibrente: Leibrente bietet planbare Zahlungen und gesichertes Wohn- oder Nießbrauchrecht, dafür keinen vollen Kaufpreis auf einmal.
- Vergleich zur Umkehrhypothek: Bei der Umkehrhypothek bleiben Eigentum und Grundbuchposition erhalten, dafür wächst die Verschuldung und mindert das Erbe.
Auswirkungen auf Erben und Pflichtteil
Mit dem Rückmietverkauf wird die Immobilie sofort aus dem späteren Nachlass herausgelöst. Statt des Objekts verbleibt in der Regel nur noch der verbleibende Kaufpreis (abzüglich Verbrauch, Schenkungen und Kosten) im Vermögen. Für Erben bedeutet das: Sie erben Geld oder Geldanlagen – aber keine Immobilie mehr.
Pflichtteilsberechtigte können durch den Rückmietverkauf mittelbar benachteiligt sein, weil das werthaltige Immobilienvermögen in Liquidität umgewandelt und zu Lebzeiten verbraucht oder verschenkt werden kann. Anders als bei der klassischen Schenkung liegt jedoch ein entgeltlicher Verkauf vor, sodass kein Pflichtteilsergänzungsanspruch wegen Schenkung entsteht.
- Keine Immobilie im Nachlass: Erben können das Objekt nicht mehr selbst nutzen oder behalten.
- Kapitalverbrauch: Wird der Kaufpreis vollständig verbraucht, kann der Nachlass deutlich geringer ausfallen.
- Schenkungen aus Kaufpreis: Schenkungen an einzelne Kinder können Pflichtteilsergänzungsansprüche anderer Pflichtteilsberechtigter auslösen.
Der Rückmietverkauf ist damit ein Instrument für maximale Sofortliquidität mit Mietfortsetzung – geeignet für Personen mit absehbarem Umzug, hohem Kapitalbedarf und geringem Wunsch, eine Immobilie zu vererben. Ohne rechtliche Prüfung und sorgfältige Mietvertragsgestaltung ist das Risiko jedoch erheblich.
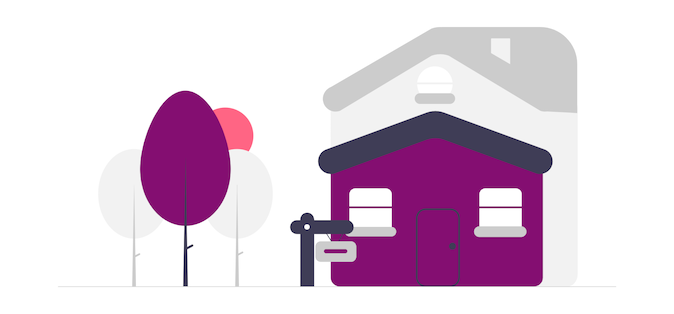
Steuern, Pflichtteil und Erben berücksichtigen
Die Entscheidung für ein Verrentungsmodell beeinflusst nicht nur den Geldfluss zu Lebzeiten, sondern auch die spätere Erbfolge. Je nach Modell verändert sich die Zusammensetzung des Nachlasses, es entstehen steuerliche Folgen oder Pflichtteilsfragen. Dieses Kapitel zeigt, wie Leibrente, Teilverkauf, Nießbrauch oder Umkehrhypothek sich auf Erbschaftsteuer, Pflichtteil und Gestaltungsspielräume auswirken.
Besonders relevant sind dabei: die Ausnutzung von Freibeträgen, die Bewertung übertragener Rechte (Nießbrauch), die Einhaltung von Fristen und der bewusste Umgang mit der Pflichtteilsberechtigung naher Angehöriger.
Erbschaftsteuer und Nießbrauch: Freibeträge optimal nutzen
Bei der Übertragung von Immobilien oder Teilen davon greifen persönliche Freibeträge gemäß Erbschaftsteuerrecht. Kinder können 400.000 € steuerfrei erben oder geschenkt bekommen, Ehepartner 500.000 €, Enkel 200.000 €. Der Clou: Wird der Nießbrauch vorbehalten, reduziert sich der steuerpflichtige Wert der Schenkung, da der Beschenkte das Objekt nicht vollständig nutzen kann.
Die Bewertung erfolgt nach einem standardisierten Verfahren: Die ortsübliche Jahresmiete wird mit einem Altersfaktor multipliziert. Dieser Kapitalwert wird vom Immobilienwert abgezogen. So lassen sich größere Vermögen übertragen, ohne den Freibetrag zu überschreiten.
- Freibeträge: alle 10 Jahre neu nutzbar (gestaffelte Schenkungen möglich).
- Nießbrauchabzug: reduziert den steuerlichen Wert um teils 20–40 % des Objektwerts.
- Mehrfachvorteil: Steuerersparnis + Versorgungssicherheit für den Schenker.
Pflichtteil und 10-Jahres-Frist bei Schenkung
Plichtteilsberechtigte – insbesondere Kinder oder Ehepartner – haben Anspruch auf einen Teil des gesetzlichen Erbteils. Wird zu Lebzeiten Vermögen verschenkt, kann es trotzdem in die Pflichtteilsberechnung einfließen, sofern es innerhalb von 10 Jahren vor dem Tod erfolgte (§ 2325 BGB). Doch Vorsicht: Wenn der Schenker sich einen Nießbrauch oder ein Wohnrecht vorbehält, beginnt die 10-Jahres-Frist im Regelfall nicht zu laufen, solange er die wirtschaftliche Nutzung weitgehend behält. In diesen Fällen bleibt der volle Wert pflichtteilsrelevant.

Dieser externe Inhalt kommt von YouTube. Informationen zum Datenschutz bei YouTube finden Sie unter Google - Datenschutzerklärung & Nutzungsbedingungen.
- Mit Nießbrauch: Fristbeginn erst mit Verzicht auf Nutzung.
- Ohne Nutzungsvorbehalt: jährlicher Abschmelzungsmechanismus → 10 % p.a.
- Pflichtteilsergänzung: anteilige Hinzurechnung zur Erbmasse.
Auswirkungen auf Erben je Modell
Je nachdem, welches Verrentungsmodell gewählt wurde, verändert sich der Nachlass – sowohl faktisch als auch rechtlich. Manche Modelle lassen Immobilieneigentum im Nachlass, andere nicht. Bei darlehensbasierten Lösungen wie der Umkehrhypothek kann die Erbmasse durch Schulden belastet sein. Für Erben ist es entscheidend zu wissen, welche Rechte und Pflichten auf sie zukommen.
- Leibrente: Immobilie ist verkauft, bleibt nicht im Nachlass. Keine Belastung durch Schulden, aber kein Erbe aus dem Objekt.
- Teilverkauf: Restanteil gehört zum Nachlass. Erben müssen mit dem Käufer kooperieren oder auszahlen.
- Nießbrauchübergabe: Die Immobilie gehört beim Tod nicht mehr zum Nachlass, da das Eigentum bereits zu Lebzeiten übertragen wurde. Der Nachlass wird durch die Übertragung vermindert; allerdings bleibt sie – je nach Zeitpunkt und Nießbrauchsgestaltung – pflichtteils- und steuerlich relevant.
- Umkehrhypothek: Immobilie im Nachlass, aber mit Schuld belastet. Tilgung durch Erben oder Verkauf notwendig.
Wer Immobilienverrentung als Werkzeug der Nachlassgestaltung nutzt, sollte die steuerlichen und erbrechtlichen Folgen mitdenken.
Immobilienverrentung erfolgreich umsetzen
Die Wahl des passenden Verrentungsmodells ist nur der erste Schritt. Entscheidend ist, die Umsetzung sauber zu strukturieren: vom Wertermittlungsprozess bis zur Vertragsunterzeichnung. Dieses Kapitel führt Sie durch die praktische Umsetzung, zeigt typische Kostenfallen auf und erklärt, wie sich Pflegekosten, Umbauten oder familiäre Ziele konkret finanzieren lassen.
Im Mittelpunkt stehen dabei die richtigen Abläufe, juristische Absicherung, Auswahl seriöser Anbieter und die Berücksichtigung persönlicher und familiärer Rahmenbedingungen.
Zielgruppen und Eignung der Modelle
Verrentung eignet sich vor allem für Eigentümer ab etwa 65 Jahren mit einer schuldenfreien oder weitgehend abbezahlten Immobilie. Voraussetzung ist ein konkreter Liquiditätsbedarf, etwa zur Altersvorsorge, Pflegefinanzierung oder vorweggenommenen Erbfolge. Auch wer keine Erben hat oder seinen Lebensstandard sichern will, kann von Verrentungsmodellen profitieren.
Die Wahl des Modells hängt stark von den individuellen Zielen ab:
- Leibrente: Für dauerhaft planbare Zahlungen und vollständige Eigentumsübertragung.
- Teilverkauf: Bei moderatem Kapitalbedarf und Wunsch, Miteigentum zu behalten.
- Nießbrauchübergabe: Für steueroptimierte Übertragungen an Kinder mit Erhalt der Nutzung.
- Umkehrhypothek: Für Eigentümer mit Erhaltungswunsch und kalkulierbarem Schuldenrisiko.
Schritt-für-Schritt: Bewertung, Anbieter, Notar
Ein strukturierter Ablauf hilft, Risiken zu minimieren und die bestmögliche Lösung zu finden. Typischer Projektablauf in 7 Schritten:
- Wertgutachten: Lassen Sie ein Verkehrswertgutachten anfertigen – möglichst unabhängig vom Anbieter.
- Modellwahl: Entscheiden Sie nach Zielsetzung, Steuerfolgen und familiärer Situation.
- Anbietervergleich: Holen Sie mehrere Angebote ein. Achten Sie auf Zahlungsmodalitäten, Rechte, Nebenkosten und Rückkaufbedingungen.
- Vertragsprüfung: Ziehen Sie einen Notar oder Fachanwalt hinzu – insbesondere bei Teilverkauf oder Leibrente.
- Notartermin: Beurkundung des Kauf- oder Verrentungsvertrags. Beachtung von Formvorschriften!
- Grundbucheintragung: Wohnrecht oder Nießbrauch müssen vorrangig gesichert sein.
- Auszahlung: Nach Eintragung folgen Auszahlung und ggf. Beginn der Rentenzahlung oder Entgeltpflicht.
Kosten: Notar, Makler, Steuern
Verrentungslösungen verursachen Nebenkosten, die oft übersehen werden. Eine vollständige Kalkulation umfasst:
- Notar- und Grundbuchkosten: ca. 1,5–2,0 % des Immobilienwerts.
- Maklergebühren: bei Vermittlung durch Makler i. d. R. 3–6 % (regional unterschiedlich).
- Grunderwerbsteuer: bei Verkauf durch Käufer zu tragen, aber indirekt einkalkuliert (3,5–6,5 %).
- Laufende Kosten: Nutzungsentgelt (Teilverkauf), Verwaltungspauschalen, Servicegebühren.
- Steuerlast: Ertragsanteil bei Leibrente, ggf. Spekulationsgewinn bei kürzerer Eigentumsdauer.
Teilverkauf oder Vollverrentung?
Die Entscheidung hängt vom Kapitalbedarf, der Lebenssituation und der Erbenstruktur ab:
- Teilverkauf: Eigentum anteilig erhalten, flexibler Rückkauf möglich, aber laufende Kosten und Abhängigkeit vom Investor.
- Vollverrentung: z. B. Leibrente – vollständige Liquiditätsgewinnung, keine spätere Rücknahme, planbare Rente, aber vollständiger Eigentumsverlust.
Pflegekosten im Alter durch Verrentung finanzieren
Ambulante Pflege, Umbauten, 24-Stunden-Kräfte – Pflege kostet. Eine Immobilie kann helfen, diese Ausgaben zu stemmen, ohne sofort verkauft zu werden. Gerade bei häuslicher Pflege ist planbare Liquidität entscheidend.
- Leibrente: deckt monatliche Pflegekosten (z. B. Haushaltshilfen, Pflegedienst).
- Einmalzahlung: ermöglicht Investitionen (z. B. Treppenlift, Badumbau).
- Teilverkauf: schafft sofortigen Kapitalpuffer – Nutzungsentgelt muss einkalkuliert werden.
- Nießbrauchlösung: sichert Eigentum bei Übertragung auf Kinder – Kombination mit Pflegevertrag möglich.
Ob Leibrente, Teilverkauf oder Umkehrhypothek – mit guter Planung lassen sich Immobilien gezielt für den Ruhestand nutzen. Die Nachlassplanung gewinnt dadurch an Klarheit, Sicherheit und Gestaltungsspielraum.
E-Book: „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“
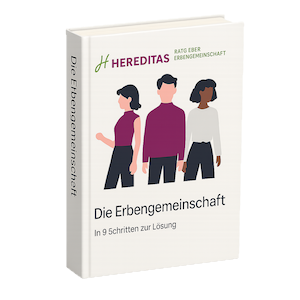
- Gratis-E-Book „Die Erbengemeinschaft – In 9 Schritten zur Lösung“: Mein Leitfaden, wie Sie Ihren Weg aus der Erbengemeinschaft finden. Exklusive und kostenfreie Zugabe zum Newsletter!
- Checkliste Todesfall: Die wichtigsten Aufgaben für Angehörige in den ersten Tagen und Wochen nach dem Todesfall. Ebenfalls kostenlos zum Newsletter!
- Der Newsletter: Nichts mehr verpassen. Meine exklusiven Insider-Tipps, neueste Beiträge und aktuelle Entwicklungen!
Häufig gestellte Fragen
Was ist Immobilienverrentung und welche Modelle gibt es?
Welche Nachteile kann eine Immobilienverrentung haben?
Warum ist die Eintragung von Wohnrecht oder Nießbrauch im Grundbuch wichtig?
Worin unterscheidet sich eine Umkehrhypothek von einer Leibrente?
Quellenangaben und weiterführende Literatur
Die Informationen auf dieser Seite sind sorgfältig recherchiert und zusammengetragen. Folgende Quellen und weiterführende Literatur empfehle ich im Kontext Immobilienverrentung Nachlassplanung:- Nießbrauch im BGB: §§ 1030–1089 BGB
- Wohnrecht (Wohnungsrecht): § 1093 BGB
- Hypothek im BGB: §§ 1113–1190 BGB
- Leibrente im BGB: §§ 759–761 BGB
- Mietvertrag (Rückmietverkauf): § 535 BGB
- Pflichtteilsergänzung bei Schenkungen: § 2325 BGB
- Bewertung von Nießbrauch und Wohnrecht: § 14 BewG
- Erbschaftsteuerliche Freibeträge: § 16 ErbStG

Dieser Beitrag wurde recherchiert und veröffentlicht von Dr. Stephan Seitz
Mein Name ist Dr. Stephan Seitz. Ich habe an der LMU München Jura studiert, 2006 mein Staatsexamen abgelegt und anschließend an der Universität Regensburg promoviert. Seitdem verbinde ich juristisches Fachwissen mit meinen eigenen Erfahrungen im Erbrecht und lasse dieses Wissen in meinen Ratgeber einfließen. Mehr zu meinem Werdegang und beruflichen Stationen finden Sie bei Interesse auf LinkedIn.
Die Idee zu dieser Webseite entstand, als ich selbst Teil einer Erbengemeinschaft war. Ich habe die Spannungen, rechtlichen Fragen und Unsicherheiten, die viele Miterben belasten, hautnah erlebt. Mit HEREDITAS » Ratgeber Erbengemeinschaft möchte ich juristische Grundlagen und Lösungswege verständlich darstellen und so Orientierung bieten.
Meine Inhalte sind für Sie kostenfrei. Mögliche Werbelinks, die zur Finanzierung beitragen, sind transparent gekennzeichnet.
Sie erreichen mich über die Kontaktseite.


Kommentare
Bislang keine Kommentare.Schreiben Sie Ihren Kommentar!